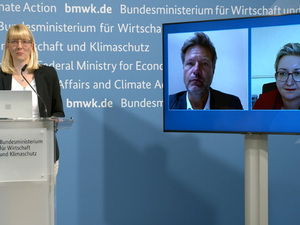KfW-Studie: Regionale Energiewende erfordert 535 Milliarden Euro

Die Transformation der Energie- und Wärmesysteme auf regionaler Ebene stellt die Energieversorger vor erhebliche finanzielle Herausforderungen. Laut einer Analyse der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Pwc Deutschland im Auftrag der (Kreditanstalt für Wiederaufbau) KfW werden bis 2045 Investitionen in Höhe von insgesamt 535 Milliarden Euro erforderlich. Der Großteil, rund zwei Drittel, entfällt dabei auf den Zeitraum bis 2035.
Finanzierungslücke von 346 Milliarden Euro schließen
Die Studie verdeutlicht, dass die Energieversorger und ihre Eigentümer neue Wege der Finanzierung erschließen müssen. Aus eigener Innenfinanzierung können die Unternehmen lediglich etwa ein Viertel des Investitionsbedarfs decken. Weitere zehn Prozent lassen sich über neu eingeworbene Zuschüsse und Baukostenzuschüsse finanzieren.
Damit bleibt eine erhebliche Finanzierungslücke von 346 Milliarden Euro, was 65 Prozent des Gesamtbedarfs entspricht. Diese Lücke muss durch zusätzliches Eigenkapital in Höhe von geschätzt 47 Milliarden Euro sowie durch Fremdkapital in Höhe von 299 Milliarden Euro geschlossen werden.
Höchster Kapitalbedarf muss bis 2035 erfolgen
Der größte Teil der Investitionen muss in den kommenden zehn Jahren erfolgen. Bis 2035, dem erwarteten Höhepunkt der jährlichen Investitionen, werden rund 40 Milliarden Euro an zusätzlichem Eigenkapital und 218 Milliarden Euro an Fremdkapital benötigt. Die Berechnungen gehen davon aus, dass die investierenden Unternehmen eine Eigenkapitalquote von mindestens 25 Prozent beibehalten.
Grenzen klassischer Kreditfinanzierung: Stadtwerke betroffen
Die Studie weist darauf hin, dass klassische Bankkredite künftig an ihre Grenzen stoßen werden. Aktuell belaufen sich die von deutschen Banken an Energieversorger vergebenen Kredite auf etwa 130 Milliarden Euro. Selbst unter Berücksichtigung von Tilgungen wäre bis 2035 ein Nettozuwachs von maximal 100 Milliarden Euro realistisch, falls der zusätzliche Fremdkapitalbedarf ausschließlich über neue Kredite gedeckt würde. Gerade bei regionalen und auf die Energiewirtschaft spezialisierten Banken sind die Spielräume für eine deutliche Kreditausweitung begrenzt.
Stadtwerke sind besonders betroffen, da ihre Gewinne häufig zur Querfinanzierung anderer kommunaler Aufgaben verwendet werden und somit nur eingeschränkt für Investitionen in die Energiewende zur Verfügung stehen.
Neue Finanzierungsinstrumente notwendig
Um die Finanzierungslücke zu schließen, sind laut Studie neue Ansätze und Instrumente erforderlich. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW, betont:
„Die Energieversorger müssen in den kommenden Jahren gewaltige Investitionen für die Energiewende stemmen. Die klassische Kreditfinanzierung stößt dabei an ihre Grenzen. Für eine erfolgreiche Modernisierung der Energieinfrastruktur braucht es auch auf politischer Ebene Überlegungen, wie der finanzielle Instrumentenkasten erweitert werden kann.“
Auch Henry Otto, Leiter Energy Consulting bei Pwc Deutschland, hebt hervor: „Unsere Analyse zeigt, dass fast alle Unternehmen in den nächsten Jahren zusätzliches Eigenkapital und erheblich mehr Fremdkapital benötigen. Neben klassischen Bankkrediten müssen neue Finanzierungsinstrumente, Partnerschaften und innovative Modelle entwickelt werden. Es braucht eine gemeinsame Anstrengung von Kommunen, Banken, Investoren und Förderinstituten, um die Energiewende erfolgreich zu finanzieren.“
Vorschläge: Finanzierungsangebot erweitern
Die Studie nennt verschiedene Ansätze, um das Finanzierungsangebot zu verbreitern:
- Schuldscheindarlehen: Größere Energieversorger könnten verstärkt auf diese Instrumente zurückgreifen.
- Förderprogramme und Ko-Finanzierungen: Konsortiale Lösungen von Förderinstituten oder eine staatliche Teilübernahme des Kreditausfallrisikos könnten die Kreditfinanzierung erleichtern.
- Verbriefung von Krediten: Die Weiterverteilung von Risiken an Dritt-Investoren kann Hausbanken entlasten und neue Kreditspielräume schaffen.
- Eigenkapitalstärkung: Ein Vorschlag des Verbands öffentlicher Banken sieht Anpassungen im Kommunalrecht vor, um kommunale Energieversorger zu stärken.
- Mezzanine-Kapital: Förderinstitute könnten hybride Kapitalinstrumente bereitstellen, die nachrangig gegenüber klassischen Krediten sind, aber keine Mitbestimmungsrechte gewähren.
- Kapitalverwaltungsgesellschaften: Diese könnten privates Kapital bündeln und als Nachrangkapital für eine Vielzahl von Energieversorgern bereitstellen.
Ausblick: Finanzierung als Schlüsselfaktor für die Energiewende
Die Ergebnisse der Studie unterstreichen, dass die erfolgreiche Umsetzung der regionalen Energiewende maßgeblich von der Schließung der Finanzierungslücke abhängt. Neben klassischen Bankkrediten sind innovative Finanzierungsinstrumente und eine breite Einbindung von Förderinstituten, Investoren und Kommunen erforderlich, um die notwendigen Investitionen in die Energieinfrastruktur zu realisieren. Die Studie in Lang oder Kurzfassung finden Sie hier.