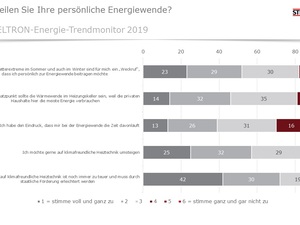Energiewende und Verschwörungsmythen: Was kann man dagegen tun?

Die Energiewende steht nicht nur vor technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen, sondern zunehmend auch vor gesellschaftlichen Widerständen. Verschwörungsmythen und Falschbehauptungen wie Windräder töten Kühe oder Solarenergie sorgt für Erderwärmung prägen vielerorts die Debatte.
Eine Pressekonferenz der KEA-BW mit Umweltministerin Thekla Walker, Autor Wolfgang Schorlau und Religionswissenschaftler Michael Blume beleuchtete die Hintergründe und diskutierte Strategien für einen konstruktiven Umgang mit Verschwörungsmythen. Die Moderation übernahm Franz Ecker von KEA-BW.
Das sind die Ursachen von Verschwörungsmythen
Verschwörungsmythen rund um erneuerbare Energien sind kein Randphänomen. Sie reichen von der Leugnung menschengemachter Erderwärmung bis hin zu Behauptungen, erneuerbare Energien seien unsicher oder schädlich. Diese Narrative findet sich nicht nur in lokalen Bürgerinitiativen, sondern wird auch auf internationaler Ebene, etwa von politischen Akteuren wie dem US-Präsidenten Donald Trump, verbreitet.
Michael Blume, Beauftragter der Landesregierung gegen Antisemitismus in Baden-Württemberg sowie Religions- und Politikwissenschaftler, sieht die Ursache unter anderem in der sogenannten Reaktanz, dem psychologischen Widerstand: Er verweist zum einen auf historische Beispiele wie die Einführung der Gurtpflicht oder das Tabakverbot, die zunächst auf Widerstand stießen und heute als selbstverständlich gelten. Dass Veränderungen anfangs abgelehnt werden, sei ganz natürlich, erklärt Blume. Er betont zum anderen die Rolle von Lobbyinteressen bei der Verbreitung von Verschwörungsmythen. Die Lobby, die im Hintergrund präsent sei, profitiere davon, wenn Menschen Solarenergie beispielsweise für unsicher oder böse halten.
Umweltministerin Thekla Walker stimmt zu, dass die Ablehnung erneuerbarer Energien oft mit der Sorge vor Veränderung verbunden ist. Aber sie versichert: „Erneuerbare Energie wird günstiger. Energie wird teurer, wenn wir uns abhängig machen von autokratischen Regimen.“

Walker betont, dass es bei der Energiewende nicht ausreicht, ausschließlich auf Daten und Fakten zu setzen. „Es gibt ein emotionales Bedürfnis.“ Die Akzeptanz der Energiewende müsse in Geschichten eingebettet und nachvollziehbar gemacht werden.
Sie verweist auf die gestiegene Sensibilität der Bevölkerung, so z.B. auch seit dem Ukraine-Krieg. Die Menschen hinterfragen: „Woher bekommen wir unser Gas? Ist es sicher? Sind wir erpressbar?" Walker appelliert: „Wir müssen die Geschichte erzählen. Wir sind nicht nur Politiker, sondern alle. Alle müssen beitragen.“
Wolfgang Schorlau, Bestseller-Autor, beschreibt in seinem aktuellen Roman Black Forest die Ängste und Spannungen rund um Windkraftprojekte. Er recherchiert seine Romane gründlich und ist auch vor Ort. Schorlau stellt fest, dass viele Konflikte oder Vorbehalte, z.B. gegen das Aufstellen von Windkrafträdern, zunächst einen rationalen Kern besitzen. Doch die Diskussionen würden häufig durch gezielte Argumentationsmuster beeinflusst: „Viele Initiativen radikalisieren sich.“ Dass diese finanzielle Unterstützung erhalten und damit auch Lobbyinteressen vertreten, hält Schorlau für plausibel.
Gesellschaftliche Dynamiken begreifen
Energiewende geht uns alle an: Für Blume sind auch biografische Aspekte entscheidend. Wenn ein Mann sein ganzes Leben in einer Werkstatt mit Verbrennern arbeitet und es jetzt heißt, dass all diese Arbeit 'falsch' war und nur E-Autos gut sind, dann fühle man sich, erklärt Blume, auf "biografischer Ebene angegriffen.“ Solche Veränderungen können für einzelne Personen belastend sein.
"Game Changer": Gesichter, Dialog und Kommunikationswege
Zudem braucht die Energiewende Gesichter. Walker betont: „Wenn da eine Person ist, die dafür steht und die anderen begeistert, als Persönlichkeit: das ist der Game Changer.“ Es braucht glaubwürdige Vertrauenspersonen in der Politik, die unabhängig von Lobbyinteressen handeln.
Blume empfiehlt, neue Kommunikationswege zu nutzen: Wege aus der Polarisierung seien nicht nur geschriebener Text und vor allem keine Textwüsten. Um die Menschen zu erreichen, müsse man Texte wieder ins Hören übersetzen, zum Beispiel durch Podcasts. Aber auch Miteinander sprechen und gezielt den Dialog suchen, seien wichtige Aspekte.
Walker stimmt zu. Man müsse: „Mit Worten Bilder malen“ und die Fakten einbetten, um sie so zu vermitteln. Ihr Appell an die Politik: „Anfangen an einem Strang zu ziehen. Es gemeinsam den Bürger*innen erzählen.“
Positive Zukunftsbilder vermitteln
Ein weiteres Thema ist die Darstellung der Energiewende. Blume verweist auf das Genre Solarpunk: Diese literarische Bewegung zeichnet sich durch ein optimistisches und utopisches Zukunftsbild aus. Blume habe sein Leben komplett umgestellt, mit erneuerbaren Energien und auch seine Familie mache mit. Er betont: „Ich versuche diese Hoffnung zu leben.“
Walker bestärkt diesen Ansatz und versichert hinsichtlich der Umstellung auf EE: „Es ist längst einiges in Bewegung." Zum utopischen Weltbild, wie bei Solarpunk sagt sie: "So wie wir heute leben; es geht viel besser und schöner. Es gibt so tolle Bilder, wie das Leben aussehen kann.“ Sie ermutigt: „Jeder Mensch braucht eine Idee: Dafür setze ich mich ein.“
Fazit: Energiewende als gemeinsame Aufgabe begreifen
Die Diskussion macht deutlich, dass die Akzeptanz der Energiewende nicht allein durch technische Fakten oder wirtschaftliche Argumente erreicht werden kann. Gesellschaftliche und emotionale Aspekte spielen eine zentrale Rolle.
Der Dialog auf Augenhöhe, das Erzählen nachvollziehbarer Geschichten und das Vorleben positiver Beispiele werden entscheidend sein, um Verschwörungsmythen entgegenzutreten und die Energiewende als gemeinsame Aufgabe voranzubringen.