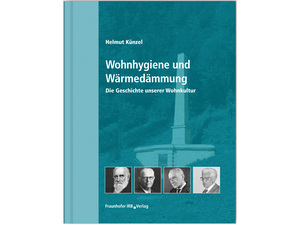Sanieren statt Neubauen: So spart die Dämmung CO₂

Energetische Sanierungen dienen nicht nur der Effizienzsteigerung, sondern sind ein zentrales Element zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors. Neben dem Umstieg auf Heizungen mit erneuerbaren Energien ist die Dämmung der Gebäudehülle ein wesentlicher Faktor zur Reduktion der Kohlendioxid-Emissionen, die Auswahl des Dämmstoffs spielt dabei auch eine Rolle.
Bausubstanz erhalten und CO₂ einsparen
Der Erhalt der vorhandenen Bausubstanz, insbesondere von massiven Wänden und Stahlbetondecken, ist der bedeutendste Faktor zur Vermeidung von CO₂ -Emissionen bei der Sanierung.
Für den Neubau eines Einfamilienhauses mit 140 Quadratmetern Wohnfläche fallen rund 65 Tonnen CO₂ an – etwa das Zehnfache der Emissionen, die für die Dämmung mit expandiertem Polystyrol (EPS) notwendig sind. Wird ein Bestandsgebäude energetisch saniert und die massiven Bauteile weiter genutzt, entfällt dieser erhebliche CO₂-Ausstoß vollständig. Der Rohbauerhalt spart somit nicht nur Energie, sondern auch wertvolle Ressourcen.
Birgit Groh vom Deutschen Energieberater-Netzwerk (DEN) betont: „Es ist beispielsweise nicht nachhaltig, einen Altbau abzureißen und den Neubau aus Beton mit einer Hanfdämmung zu versehen. Denn zur Erstellung des neuen Gebäudes wird viel mehr graue Energie benötigt, als eine auf naturnahen Baumaterialien basierte Dämmung einspart.“ Die sogenannte graue Energie umfasst den Energieaufwand für Herstellung, Transport, Verarbeitung und Entsorgung von Baustoffen.
Dämmstoffe: Welche Auswahl gibt es?
Für die Dämmung von Fassade, Dach und Kellerdecke stehen drei Hauptkategorien von Dämmstoffen zur Verfügung: synthetische Dämmstoffe auf Basis fossiler Rohstoffe (z. B. Polyurethan, Polystyrol, Phenolharz), mineralische Dämmstoffe (z. B. Steinwolle, Glaswolle) sowie naturnahe Dämmstoffe aus überwiegend nachwachsenden Rohstoffen (z. B. Holzfaser, Zellulose, Hanf, Stroh, Seegras, Jute).
Naturnahe Dämmstoffe gelten als umweltfreundliche Alternative, da sie meist einen geringeren Energieaufwand in der Herstellung aufweisen. Allerdings ist dieser Vorteil nicht immer garantiert. Fast alle naturnahen Dämmstoffe enthalten Zusatzstoffe zur Verbesserung der baulichen Eigenschaften, insbesondere des Brandschutzes.
Frank Hettler von Zukunft Altbau erläutert: „Das sind Zusatz- und Hilfsstoffe zur Verbesserung der baulichen Eigenschaften wie dem Brandschutz. Zum Ende der Lebensdauer wird es dadurch erheblich erschwert, naturnahe Dämmstoffe einfach in natürliche Kreisläufe zurückzuführen. Daher müssen sie aktuell ähnlich wie andere Dämmstoffe fachgerecht entsorgt werden.“
Synthetische und mineralische Dämmstoffe dominieren mit über 80 Prozent Marktanteil, da sie kostengünstig sind und sehr gute Dämmwerte bieten. Sie ermöglichen zudem geringere Dämmstärken bei gleicher Dämmwirkung. Die stoffliche Verwertung oder das Recycling dieser Materialien ist derzeit jedoch nur eingeschränkt möglich.
Lesen Sie hierzu auch: Marktübersicht Naturdämmstoffe: Materialien und Preise
CO₂-Bilanz: Dämmung amortisiert sich schnell
Unabhängig vom Material übersteigt die CO₂-Einsparung durch die Dämmung die Emissionen, die bei der Herstellung der Dämmstoffe entstehen, deutlich. Bei einem Haus mit 140 Quadratmetern Wohnfläche verursacht die Produktion von EPS-Dämmplatten knapp sechs Tonnen CO₂. Über die Lebensdauer der Dämmung wird jedoch ein Mehrfaches dieses Wertes eingespart. Je nach Dämmstoff und Heizungsart amortisiert sich der CO₂-Ausstoß innerhalb von maximal zwei Jahren.
Gebäude ohne gedämmte Außenhülle verschwenden erhebliche Energiemengen. Die für die Dämmung aufgewendete Energie geht bei ungedämmten Gebäuden ein Vielfaches über Schornsteine und Außenhüllen verloren. Auch bei Versorgung mit erneuerbaren Energien bleibt die Effizienz ungedämmter Gebäude schlecht und die Energiekosten hoch. Langfristig sind ungedämmte Bestandsgebäude daher nur in Ausnahmefällen vertretbar.
Praxis-Beispiel: Bauprojekt in Basel nutzt Bausubstanz und alte Materialien
Das Sanierungsprojekt ELYS in Basel zeigt, wie konsequente Wiederverwendung von Bausubstanz und Baumaterialien CO₂-Emissionen reduziert. Bei der Umnutzung eines ehemaligen COOP-Verteilzentrums mit Großbäckerei zu einem Kultur- und Gewerbehaus blieb die Rohbaustruktur erhalten.
Für die neue Fassade wurden Materialien von anderen Baustellen verwendet, darunter alte Holzbalken, Dämmstoffreste, falsch produzierte Fenster und Blechverkleidungen. Durch dieses Vorgehen konnten rund 91 Tonnen CO₂ gegenüber einer komplett neuen Fassade eingespart werden.
Insgesamt vermied der Umbau durch den Erhalt der Gebäudestruktur etwa 7.000 Tonnen CO₂ im Vergleich zu einem Neubau – vor allem durch die Weiternutzung von Wänden, Stützen und Decken aus Beton. Der Erhalt der Rohbausubstanz war damit für fast 99 Prozent der CO₂-Einsparung verantwortlich.
Fazit und Ausblick: Klimaschutz durch Substanzerhalt und Dämmung
Für eine effektive CO₂-Vermeidung bei der Gebäudesanierung ist der Erhalt der Bausubstanz, insbesondere massiver Bauteile, der wichtigste Faktor. Die Dämmung der Gebäudehülle, unabhängig vom verwendeten Material, ist unverzichtbar für ein klimafreundliches Gebäude.
Die Auswahl des Dämmstoffs sollte unter Berücksichtigung von Dämmwirkung, Herstellungsenergie, Entsorgungsfähigkeit und Zusatzstoffen erfolgen. In Kombination mit einer Heizanlage auf Basis erneuerbarer Energien lässt sich der Gebäudeenergieverbrauch nachhaltig senken.