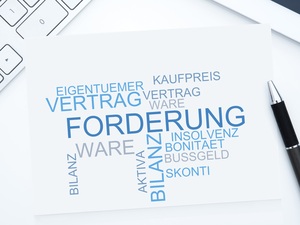Rechtsanspruch auf Reparatur: Reparieren statt Wegwerfen

Jeder Bundesbürger produziert gut zehn Kilogramm Elektroschrott pro Jahr. In ganz Europa entsteht durch die Entsorgung von Smartphones, alten Laptops, Waschmaschinen, Kühlschränken oder Fernsehern jedes Jahr ein mehrere Millionen Tonnen schwerer Müllberg. Der Europäischen Union ist das zu viel. Deshalb haben sich Kommission, Rat und Parlament auf die Richtlinie zum „Recht auf Reparatur“ verständigt. Sie trat am 1. Juli 2024 in Kraft und muss bis zum 31. Juli 2026 in deutsches Recht umgesetzt werden.
Dazu müssen in Deutschland vor allem im Bürgerlichen Gesetzbuch Paragrafen zum Gewährleistungsrecht geändert und Verwaltungsvorschriften angepasst werden. Bis Ende Juli war das noch nicht passiert. Außerdem muss die Bundesregierung gemäß der Richtlinie eine Maßnahme erlassen, die Kunden unterstützt, wenn sie Reparaturen in Auftrag geben. Das könnte ein finanzieller Zuschuss oder eine Senkung der Umsatzsteuer für Reparaturen sein.
Richtlinie zum Recht auf Reparatur gilt nicht für alle Produkte
Die Richtlinie gibt Verbrauchern das Recht, auch nach der gesetzlichen Gewährleistungszeit die Reparatur ihrer Produkte in einem Betrieb ihrer Wahl zu angemessenen Preisen zu verlangen. Die Kosten müssen sie selbst tragen. Allerdings gilt das nur, wenn das defekte Gerät in Anhang II der Richtlinie zum Recht auf Reparatur aufgeführt ist. Bislang nennt dieser unter anderem
- Haushaltsgeräte,
- Elektronische Geräte wie Smartphones, Laptops oder Displays,
- Fahrzeuge mit Batterien, sofern sie keine Autos sind,
- Kühlgeräte,
- Schweißgeräte,
- Server und
- Datenspeicher.
Hersteller dieser Geräte verpflichtet die Richtlinie, Reparaturen ihrer Produkte zu ermöglichen und zu erleichtern. Kaum ein Handwerksbetrieb wird daher von der Pflicht betroffen sein, eigene Produkte zu reparieren. Allerdings könnten er sich selbst als Kunde auf das Recht zur Reparatur berufen oder Reparaturaufträge von Herstellern übernehmen.
Umfangreicher Pflichtenkatalog für Hersteller
Wer Reparaturdienste anbietet sollte wissen, wie ihn Hersteller dabei unterstützen müssen. Diese verpflichtet die Richtlinie zur Reparatur,
- Ersatzteile sieben Jahre lang vorzuhalten
- und binnen maximal zehn Tagen zu liefern.
- Produkte müssen sich zudem mit Ersatzteilen von Drittanbietern oder im 3D-Druck hergestellten Ersatzteilen reparieren lassen.
- Werkzeuge und Software, die für die Reparatur nötig sind, müssen frei erhältlich sein.
- Hersteller dürfen keine Software verwenden, die die Reparatur durch Dritte verhindert.
- Autorisierungsverfahren, die nur der Hersteller freischalten kann, sind fortan verboten.
Lassen sich Geräte nicht reparieren, gilt das künftig als Mangel
Sollten Hersteller gegen diese Pflichten verstoßen oder sie ihre Produkte so gestalten, dass diese nur mit massivem Aufwand repariert oder nur unter Inkaufnahme von Schäden demontiert werden können, ist das nach der EU-Richtlinie künftig ein Mangel im Sinne des Zivilrechts.
Erfüllt ein Hersteller die Richtlinie und entscheidet sich ein Kunde während der gesetzlichen Gewährleistungszeit für eine Reparatur statt einen Umtausch verlängert sich seine Gewährleistung dagegen in Deutschland von zwei auf drei Jahre.
Handwerker profitieren durch mehr Reparaturaufträge
Laut einer Studie des Instituts für Instituts für Handelsforschung in Köln sollten sich Handwerker auf eine steigende Zahl von Anfragen von Reparaturen und entsprechenden Aufträgen einstellen. Denn Kunden ließen 2024 jedes zweite defekte Gerät reparieren.
Wer von dieser Nachfrage profitieren will, muss sich jedoch vorbereiten. Denn aktuell finden drei von vier Fachhändlern nicht die Mitarbeiter, die sie dazu bräuchten.