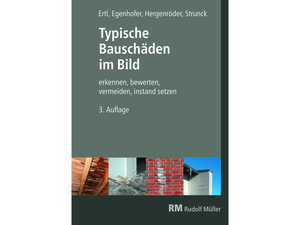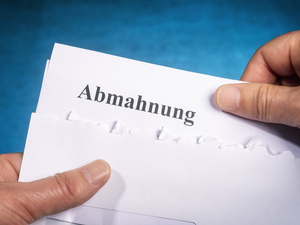Arbeitszeitgestaltung: Wie Sie Potenziale voll ausschöpfen

Kurz im Überblick:
- Arbeitszeiterfassung ist gesetzlich vorgeschrieben – auch Umkleide- und Pausenzeiten zählen.
- Tägliche Arbeitszeit darf 10 Stunden betragen, wenn ein zeitlicher Ausgleich erfolgt.
- Die Vier-Tage-Woche kann die Zufriedenheit steigern, erfordert aber genaue betriebliche Planung.
- Flexible Modelle wie Gleitzeit oder Vertrauensarbeitszeit brauchen klare Regeln und Kontrolle.
- Jugendliche, Schwangere und Minijobber unterliegen besonderen Arbeitszeitvorgaben.
Arbeitszeitmanagement ist ein vielversprechender Einflussfaktor zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit eines SHK-Handwerksbetriebs. In diesem Zusammenhang ist die Vier-Tage-Woche ein großes Thema. Doch die Herausforderungen der flexiblen Arbeitszeitgestaltung stecken im Detail. Denn sie erfordert nicht nur Kreativität, sondern vor allem auch die Kenntnis von gesetzlichen Regelungen. Dies macht es kleinen und mittelständischen Handwerksunternehmen nicht einfach, neue Arbeitszeitregeln einzuführen.
An erster Stelle sei hier das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) genannt. Selbiges regelt die Höchstdauer der täglichen Arbeitszeit sowie Ruhezeiten und Pausen. Ferner legt es die Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeiten fest. Auch der Schutz der Sonn- und Feiertage als Tage der Arbeitsruhe ist Gegenstand des Gesetzes. Motiv des Gesetzes ist es, den Gesundheitsschutz der Beschäftigten sicherzustellen. Da sich die Arbeitswelt in einem Wandel befindet, in welchem der Wunsch und die Notwendigkeit nach flexiblen Lösungen groß ist, setzt das Arbeitszeitgesetz einen Rahmen – nicht immer zum Wohlergehen der Handwerksunternehmen.
Das Arbeitszeitgesetz richtet sich an Beschäftigte, das heißt vor allem an Arbeiter und Angestellte. Es ist nicht nur für klassische Vollzeitkräfte bestimmt, sondern auch für Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte in Minijobs. Allerdings gelten für leitende Angestellte und Geschäftsführer andere Regeln. Für bestimmte Personengruppen gelten spezielle Arbeitszeitregelungen, die zum Beispiel aus dem Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) und dem Mutterschutzgesetz (MuSchG) abgeleitet werden.
Das ist wichtig bei Arbeitszeiterfassung und -kontrolle
Eine zentrale Aufgabe des Arbeitszeitgesetzes ist die Arbeitszeiterfassung. Dies kann beispielsweise durch Stundenzettel, Stempeluhr oder Apps umgesetzt werden. Diese Dokumentation muss bis zu zwei Jahre aufbewahrt werden. Dabei geht es um die präzise Aufzeichnung des Beginns und des Endes der täglichen Arbeitszeit, der Arbeitsstunden sowie der Pausen. Es soll damit eine Überschreitung der zulässigen Arbeitszeiten verhindert werden. Auch Überstunden müssen dokumentiert werden.
Aber nicht nur die Anwesenheit, sondern auch die Abwesenheit bedarf der Erfassung. Dies betrifft Urlaub, Krankheit und Sonderurlaub. Damit ist der Erfassung aber noch nicht Genüge getan. Denn gemäß einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes gehören auch Umkleide- und Waschzeiten dazu. Vorausgesetzt, das Tragen bestimmter Arbeitskleidung wird vom SHK-Unternehmen vorgeschrieben. Dann muss der Zeitaufwand zum Umkleiden und Waschen in die Arbeitszeiterfassung einfließen.
Auch Betriebsversammlungen als gesetzlich vorgeschriebene Zusammenkünfte, bei denen die Unternehmensleitung über wichtige betriebliche Angelegenheiten informiert, gelten als Arbeitszeit und sind entsprechend zu erfassen und zu bezahlen. Betriebsausflüge haben meist etwas Erheiterndes an sich, aber auch hier gilt die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung, da sie einem guten Betriebsklima dienlich sind.
Wo es Regeln gibt, gibt es auch Verstöße. Somit stellt sich die Frage, wer die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes kontrolliert. Diese Aufgabe obliegt dem Gewerbeaufsichtsamt beziehungsweise dem Amt für Arbeitsschutz. Das zuständige Aufsichtsamt hat die Befugnis, vom Arbeitgeber erforderliche Auskünfte und Unterlagen für eine Überprüfung zu verlangen. Der Beschäftigte hat die Möglichkeit, bei Verstößen gegen das Arbeitszeitgesetz dem zuständigen Amt eine Meldung zukommen zu lassen. Die Folge ist eine Kontrolle, die allerdings ohne Verdachtsmoment der Ausnahmefall ist.