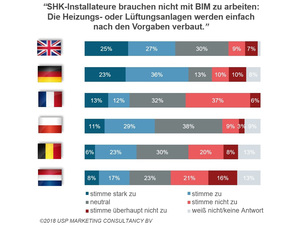Gebäudetyp E: Digitaler Planungsansatz für nachhaltiges Bauen

Die Bauwirtschaft steht seit Jahren unter erheblichem Kostendruck und leidet unter komplexen Regulierungen. Mit dem Gebäudetyp E hat der Gesetzgeber nun einen Paradigmenwechsel eingeleitet: Erstmals ist es möglich, auf technische Normen zu verzichten, sofern diese lediglich Komfort- oder Ausstattungsmerkmale betreffen.
Das Bundeskabinett hat am 6. November 2024 den entsprechenden Gesetzesentwurf zur zivilrechtlichen Umsetzung im Bauvertragsrecht beschlossen. Künftig gilt: Nur vertraglich vereinbarte Leistungen sind geschuldet. Das entlastet Planende und Ausführende haftungsrechtlich und schafft Freiräume für Innovationen, die angesichts steigender ESG-Anforderungen und Kostendruck dringend benötigt werden.
Einsparpotenziale: Gezielter Verzicht auf Standards
Das Bundesjustizministerium schätzt das Einsparpotenzial bei den Herstellungskosten im Wohnungsbau auf rund 10 Prozent: das entspricht etwa 8 Milliarden Euro pro Jahr. Je nach Maßnahme und Gebäudetyp sind sogar bis zu 25 Prozent möglich, insbesondere durch den Verzicht auf überdimensionierte technische Ausstattung oder kostenintensive Komfortdetails. Beispielrechnungen zeigen, dass allein eine reduzierte Trittschalldämmung rund 56 Euro pro Quadratmeter einsparen kann.
Weitere signifikante Einsparungen ergeben sich bei optimierten Tragwerken und reduzierter technischer Erschließung (etwa 200 Euro pro Quadratmeter), bei der Rücknahme brandschutzbedingter Sonderlösungen (circa 150 Euro pro Quadratmeter) sowie beim Verzicht auf Zertifizierungen oder überzogene Barrierefreiheitsanforderungen (jeweils 100 bis 150 Euro pro Quadratmeter).
In Hamburg wurden im Rahmen der Initiative Kostenreduziertes Bauen 65 Einzelmaßnahmen identifiziert, deren kombinierter Effekt über 1.000 Euro pro Quadratmeter beträgt – das entspricht mehr als 20 Prozent Reduktion bezogen auf das aktuelle Median-Kostenniveau von etwa 4.600 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche.
Digitale Prozesse gelten als Voraussetzung für rechtssichere Umsetzung
Die neuen Freiräume beim Gebäudetyp E gehen mit erhöhten Nachweispflichten einher. Wer von Standards abweicht, muss die Erfüllung der Schutzziele detailliert belegen. Digitale Planungs- und Modellierungsprozesse wie Building Information Modeling (BIM) und digitale Zwillinge werden daher unerlässlich. Sie ermöglichen Variantenbildung, Simulation und belastbare Dokumentation, um die Einsparpotenziale auszuschöpfen und zugleich juristische Risiken zu minimieren.
Im Neubau eröffnen sich gezielte Spielräume insbesondere bei Tragwerk, Ausbau und technischer Gebäudeausrüstung. Abweichungen von Normen und technischen Baubestimmungen sind möglich, sofern die Schutzziele auf anderem Wege erreicht werden. Durch suffizienzorientierte Planung können Bauteile auf das statisch erforderliche Maß begrenzt und damit Materialeinsatz, CO₂-Fußabdruck und Kosten reduziert werden.
Digitale Werkzeuge erlauben es, Einsparpotenziale modellbasiert zu identifizieren und technisch abzusichern. Abweichungen lassen sich im BIM-Modell bauteilgenau simulieren, alternative Aufbauten und Installationen dokumentieren sowie Nachweise zur Statik, thermischen Hülle und Energieeffizienz automatisiert erstellen. Diese Planungstiefe ermöglicht eine präzise Kostenzuordnung nach DIN 276 und zeigt die Auswirkungen auf Kosten und Treibhausgasemissionen.

Gebäudetyp E und BIM im Bestand: Ressourcenschonend und flexibel
Im Gebäudebestand greifen Gebäudetyp E und BIM besonders effektiv ineinander. Altbauten müssen nicht nach den heute allgemein anerkannten Regeln der Technik saniert werden, sofern die bauordnungsrechtlichen Schutzziele erfüllt bleiben. Statt pauschaler Aufrüstung können Planende das technische Niveau des Bestands gezielt fortschreiben – funktional ausreichend, ressourcenschonend und wirtschaftlich tragfähig.
Digitale Zwillinge, erstellt aus 3D-Scans und Planungsmodellen, liefern die Grundlage für präzise Dokumentation und technische Validierung von Abweichungen. Varianten von Sanierungsmaßnahmen können simuliert und dokumentiert werden, etwa unterschiedliche Dämmungen, Fenstertypen oder Installationskonzepte. Auch bei der Technischen Gebäudeausrüstung lassen sich erhebliche Einsparungen erzielen, beispielsweise durch den Verzicht auf mechanische Lüftung oder überdimensionierte Heizlastauslegung.
Entscheidend ist, dass Abweichungen von den allgemein anerkannten Regeln der Technik nur dann wirksam vereinbart sind, wenn die Bauherrschaft den funktionalen Unterschied versteht und bewusst zustimmt. BIM-basierte digitale Zwillinge erleichtern die rechtssichere Kommunikation, indem Varianten und deren Konsequenzen verständlich visualisiert werden.
Ausblick: Digitale Resilienz und regulatorische Zukunftssicherheit
Building Information Modeling bietet nicht nur im aktuellen Projektkontext Vorteile, sondern sichert auch die Anschlussfähigkeit an kommende regulatorische Anforderungen. Die überarbeitete EU-Gebäuderichtlinie EPBD 2024 bringt CO₂-Grenzwerte für den gesamten Lebenszyklus, die ab 2028 für Neubauten gelten sollen. Das novellierte Gebäudeenergiegesetz 2024 verschärft die Effizienzanforderungen und erweitert die Nachweispflichten. BIM schafft die Datenbasis, um energetische Kennwerte, Materialverbräuche und Emissionen bereits im Entwurf zu erfassen und zu bewerten.
Der Gebäudetyp E markiert damit einen Wendepunkt: Reduzierte Standards, gezielte Innovationen und digitale Planungsprozesse eröffnen neue Wege für ressourceneffizientes, wirtschaftliches und zukunftsfähiges Bauen.