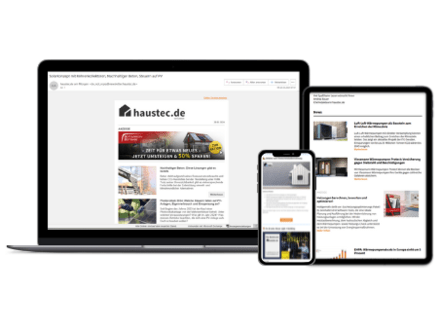Estrich-Aufheizung mit Wärmepumpen – Herausforderungen und Lösungen in Neubau und Bestand
Die Estrichtrocknung und das sogenannte Funktionsheizen stellen einen essenziellen Schritt im Bauablauf dar – sowohl im Neubau als auch bei der energetischen Sanierung von Bestandsgebäuden. Während in der Vergangenheit leistungsstarke Gas- oder Ölkessel für das notwendige Aufheizen genutzt wurden, setzen heutige Bauherren und Planer zunehmend auf Wärmepumpen. Diese bringen allerdings neue Herausforderungen mit sich, die in der gängigen Praxis und Normung bislang kaum berücksichtigt werden.