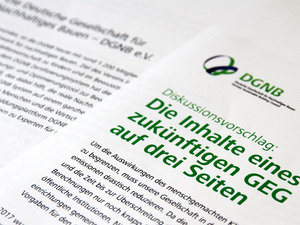Fristende naht: Warum viele Kleinfeuerstätten noch nicht EN-16510-fit sind
Die Europäische Feuerstätten Arbeitsgemeinschaft EFA setzt sich für die Belange von Industrie und Handwerk im Bereich der Holzfeuerung ein. Sie versteht sich als Ergänzung zu den bestehenden Interessenvertretungen der Branche und engagiert sich seit vielen Jahren dafür, der Holzfeuerung auch auf europäischer Ebene Gehör zu verschaffen.
Christian Droll, Mitglied des EFA-Vorstands, leitet als Geschäftsführer die Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH (RRF) und gehört zur Leitung der Prüf- und Zertifizierungsstelle. Am 9. November 2023 wurde die Normenreihe EN 16510 harmonisiert und ist seither in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union verbindlich gültig. Mit ihm spricht hier Johannes Gerstner, Verbandsberater der EFA.
Johannes Gerstner: Herr Droll, am 9. November 2025 endet die Koexistenzphase für die bisherigen Normenreihen bei Kleinfeuerstätten. Was bedeutet das konkret für die Branche?
Christian Droll: Das bedeutet, dass ab diesem Stichtag nur noch Bauprodukte in den Verkehr gebracht werden dürfen, die vollständig nach der neuen Normenreihe EN 16510 geprüft und deklariert wurden.
Die bisherigen Normen – etwa EN 13240 für Kaminöfen, EN 13229 für Kamin- und Heizeinsätze, EN 12815 für Herde oder EN 14785 für Pelletgeräte – verlieren damit ihre Gültigkeit. Diese sogenannte Koexistenzphase diente dem Übergang – sie läuft nun nach zwei Jahren aus. Eine weitere Verlängerung wurde von der Europäischen Kommission explizit abgelehnt.
Viele Hersteller werden den Wechsel im November nicht schaffen
Und wie gut ist die Branche darauf vorbereitet?
Christian Droll: Leider nur sehr eingeschränkt. Die Realität ist, dass viele Hersteller den Wechsel zur EN 16510 bis zum Ende der Koexistenzphase nicht schaffen werden.
Das liegt nicht an fehlendem Willen, sondern an strukturellen Engpässen: Die Zahl der notifizierten Prüfstellen ist dramatisch zurückgegangen – von ursprünglich 46 auf nur noch 22. Obwohl wir direkt nach Einführung der neuen Norm anerkannt wurden, wurden viele andere Stellen erst in den letzten Wochen notifiziert. Entsprechend groß ist der Rückstau bei Prüfungen und Bewertungen.
Die Hersteller haben also alle direkt nach dem Startschuss im November 2023 reagiert?
Nein, das war nicht der Fall – aber das ist auch nicht gleichzusetzen mit Untätigkeit. Zwar hat die Koexistenzphase offiziell am 9. November 2023 begonnen, aber nicht alle Hersteller haben sich sofort bei uns gemeldet. Viele mussten sich zunächst intern sortieren: Es ging darum, Produktpaletten zu überarbeiten, Prioritäten zu setzen und vor allem auch Personal für die Umstellung auf EN 16510 bereitzustellen.
Ein Teil der Branche hat relativ zügig reagiert, allerdings hat sich dann oft gezeigt, dass die Bereitstellung der notwendigen technischen Unterlagen deutlich länger dauerte als erwartet. Der Großteil der Anfragen kam letztlich erst ab dem zweiten Quartal 2025 bei uns an – also mit erheblicher Verzögerung.
Und es gibt sogar heute, im Juli 2025, noch Unternehmen, die sich bislang gar nicht gemeldet haben. Diese verzögerten Prozesse haben natürlich spürbare Auswirkungen auf unsere Prüfplanung und machen die Übergangsregelung umso wichtiger.
Christian Droll: Es braucht eine praxisorientierte Übergangslösung, die das Regelwerk nicht untergräbt, aber Spielraum schafft.
Das klingt nach einem ernsthaften Problem.
Das ist es auch. Wir haben es mit einer sehr hohen Zahl an Prüf- und Bewertungsanfragen zu tun – insbesondere auch im Bereich der sogenannten historischen Daten. Gleichzeitig fehlen ausreichend Kapazitäten, um alle nötigen Prüfberichte bis November 2025 fertigzustellen.
Eine rein formale Anwendung der EN 16510 hätte zur Folge, dass eine große Zahl an Produkten nicht mehr legal in Verkehr gebracht werden dürfte – und das wäre wirtschaftlich fatal für viele Hersteller, zumal es sich oft um langjährig etablierte Produkte handelt.
Was sind diese „historischen Daten“, von denen Sie sprechen?
Gemeint sind damit bereits vorliegende Prüfberichte auf Basis der alten Normen. Die Bauproduktenverordnung (CPR, EU 305/2011) erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen die Verwendung solcher Daten für eine Leistungsbewertung nach der neuen Norm.
Die Gruppe der notifizierten Stellen – kurz GNB – hat hierzu ein horizontales Positionspapier verabschiedet. Zusätzlich hat die Sektorgruppe SG03 WG2 sehr konkrete Leitlinien erarbeitet, wie historische Daten genutzt werden können – etwa zur Emissionsbewertung oder zur Bestimmung von Sicherheitsabständen.
Aber auch mit diesen Möglichkeiten reicht die Zeit nicht aus?
Genau. Deshalb war klar: Es braucht eine praxisorientierte Übergangslösung, die das Regelwerk nicht untergräbt, aber Spielraum schafft.
Wer war an der Entwicklung dieser Übergangsregelung beteiligt?
Die Initiative ging im Wesentlichen von drei Seiten aus. Sven Müller, unser Prüfstellenleiter und Chairman der Sektorgruppe der europäischen notifizierten Stellen für unsere Bauprodukte, zusammen mit dem HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V., der die Interessen der Hersteller vertritt, die technische Federführung übernommen.
Beide Seiten haben die Problematik frühzeitig erkannt und auf europäischer Ebene zur Sprache gebracht. Eine zentrale Rolle spielte außerdem Oskar Nieto, Technical Officer bei DG GROW – das ist die Generaldirektion der Europäischen Kommission, die für den Binnenmarkt und die Bauproduktenverordnung zuständig ist. Gemeinsam wurde eine Lösung erarbeitet, die sowohl rechtlich belastbar als auch technisch sinnvoll ist.
Was ist der AoP-Report?
Und wie sieht diese Übergangslösung konkret aus?
Kernstück der Lösung ist ein sogenannter befristeter „AoP-Report“ – das steht für Assessment of Performance Report. Das ist ein kurzer Leistungsbewertungsbericht einer notifizierten Stelle – also von uns als Prüfstelle – auf Grundlage eines vorhandenen Prüfberichts.
Dieser AoP-Report stellt die Konformitätsaussage dar, dass ein Produkt die grundlegenden Anforderungen der EN 16510 erfüllt – obwohl noch kein vollständiger neuer Prüfbericht vorliegt. Die Hersteller können mit diesem befristeten AoP-Report eine eigene Leistungserklärung (DoP) gemäß EN 16510 ausstellen.
Das klingt nach einem pragmatischen Kompromiss.
Genau das ist es. Wichtig ist aber: Der AoP-Report ist befristet – und zwar bis zum 9. November 2027. In dieser Zeit muss ein vollständiger Prüfbericht nach EN 16510 sowie ein unbefristeter AoP-Report erstellt werden. Der befristete AoP-Report schafft also lediglich einen Zeitpuffer. Er erlaubt den Herstellern, ihre Produkte weiterhin rechtskonform anzubieten und parallel die vollständige Umstellung vorzubereiten.
Welche Inhalte umfasst ein AoP-Report?
Der AoP-Report ist in der Regel zwei bis drei Seiten lang und enthält die wichtigsten Kennwerte – etwa Emissionen, Sicherheitsabstände, Brennstoffangaben und technische Besonderheiten. Es handelt sich dabei um ein europaweit einheitliches Format, das auch auf Vorgaben der Kommission basiert.
Wie wird mit offenen Fragen wie etwa der Schornsteinlast oder der Raumluftunabhängigkeit umgegangen?
Diese Angaben sind im AoP-Report enthalten. So wird etwa die Schornsteinlast gemäß Anhang ZA der Norm dokumentiert – je nach Produkt 0 - 120 kg –; durch eine administrative Prüfung bei historischen Prüfberichten oder auch höhere Lasten durch eine physische Prüfung. Auch ob ein Gerät raumluftunabhängig betrieben werden kann, wird durch eine Klassifizierung – z. B. „CA“ – im AoP-Report ausgewiesen. Und obwohl es formal nicht erforderlich ist, geben wir diese Feuerstättenklassifizierung an.
Warum ein vollständiger Prüfbericht unverzichtbar ist
Bei diesen Inhalten des AoP-Reports könnte man doch auf den Prüfbericht fast verzichten?
Das mag auf den ersten Blick so wirken – aber genau das ist ein trügerischer Eindruck. Ein AoP-Report ersetzt niemals den vollständigen Prüfbericht. Die Bauproduktenverordnung (EU) 305/2011 ist hier ganz eindeutig: Eine Leistungserklärung (DoP) des Herstellers darf nur auf Basis einer Typprüfung gemäß der anzuwendenden technischen Spezifikation – in unserem Fall also der EN 16510 – erfolgen. Das heißt: Es braucht zwingend einen gültigen Prüfbericht nach EN 16510, der die Grundlage für die Konformitätsbewertung darstellt.
Der AoP-Report basiert im besten Fall auf historischen Daten, die allerdings im alten Normen-Gewand nicht automatisch die Anforderungen der neuen EN 16510 erfüllen. Die tatsächliche Eignung historischer Daten kann nur durch ein sachgerechtes Bewertungsverfahren und im Rahmen eines vollständigen Prüfberichts festgestellt werden – auch unter Anwendung des von der GNB verabschiedeten Positionspapiers.
Wir sehen leider aktuell, dass manche Labore diese Anforderungen ignorieren. Sie stellen AoP-Reports ohne zugrunde liegenden Prüfbericht nach EN 16510 aus – das ist formal nicht zulässig und widerspricht sowohl dem Regelwerk als auch dem Sinn der Bauproduktenverordnung.
Wir als Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle legen daher höchsten Wert darauf, dass unsere AoP-Reports immer in Kombination mit einem belastbaren Bewertungsverfahren entstehen – und dass spätestens bis zur Frist am 9. November 2027 ein vollständiger Prüfbericht vorliegt. Alles andere wäre nicht nur rechtlich bedenklich, sondern auch ein Sicherheitsrisiko.
Wie ist die Resonanz auf die vorgeschlagene Übergangsregelung?
Sehr positiv – sowohl von Seiten der Hersteller als auch von den nationalen Behörden. Die EU-Kommission hat signalisiert, dass sie diesen Weg mitträgt, weil er systemkonform ist und gleichzeitig den Übergang zur EN 16510 absichert. Wir haben mit dieser Lösung die Chance, einen drohenden Markteinbruch zu verhindern, ohne dabei Kompromisse bei der Produktsicherheit einzugehen.
Zur Person: Christian Droll ist Geschäftsführer der Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH (kurz: RRF) und ehrenamtliches Vorstandsmitglied der EFA. Die RRF ist eine europäische, notifizierte Prüf- und Zertifizierungsstelle im Bereich von Feuerstätten, Abgasanlagen und Emissionsminderungseinrichtungen mit zwei Prüflaboren in Deutschland. Als Wirtschaftswissenschaftler mit dem Schwerpunkt Energiewirtschaft und -technik blickt Herr Droll mittlerweile auf 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Prüfung und Zertifizierung von Feuerstätten und Abgasanlagen zurück und ist neben den Tätigkeiten bei die RRF ebenfalls in Ausschüssen und Vorständen ehrenamtlich tätig. Als Mitglied des Vorstandes der EFA e.V. steht er dem Forschungs- und Wissenschaftsbeirates vor, vertritt das Prüflabor beim Cluster Umweltwirtschaft.NRW sowie in der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft und nimmt regelmäßig z. B. an Experten-Gesprächen des Blauen Engels oder an Wissenschaftsbeiräten der RWTH-Aachen teil.