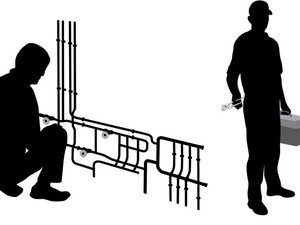Energiewende-Monitoring: Wird der Ausbau der Erneuerbaren nun gebremst?

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat das lang erwartete Gutachten zum Monitoring der Energiewende vorgestellt. Darin wird, wie von vielen erwartet, der Strombedarf Deutschlands 2030 nach unten korrigiert – wenn auch nicht so stark wie befürchtet. Statt der bisher angenommenen 750 Terawattstunden (TWh) würden in Deutschland in fünf Jahren voraussichtlich 600 bis 700 TWh benötigt, ermittelte das Gutachten. Es sei davon auszugehen, dass der Strombedarf eher am unteren Ende liege, sagte die Ministerin auf einer Pressekonferenz.
Strom: Das Ziel von 80-Prozent erneuerbaren Energien bleibt
Der voraussichtliche Strombedarf ist ein Schlüssel für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist, wie auch Reiche mehrfach betonte, den Strombedarf Deutschlands 2030 zu 80 Prozent aus erneuerbaren Quellen zu decken. Doch 80 Prozent von 600 TWh sind indes mit weniger neuen Windparks oder PV-Anlagen zu erreichen als 80 Prozent von 750 TWh.
Aufgabe des Monitoring-Gutachtens war es, nicht nur den zu erwartenden Strombedarf anhand einer Metaanalyse bereits vorliegender Studien zu ermitteln, sondern auch weitere Themenfelder zu analysieren. So sollten die beauftragten Institute EWI und BET Consulting den Stand von Versorgungssicherheit, Netzausbau, Ausbau der erneuerbaren Energien, Digitalisierung und Wasserstoffhochlauf analysieren und Handlungsempfehlungen entwickeln.
Gutachten empfiehlt mehr Flexibilität, Ausbau der Erneuerbaren und Digitalisierung
Erklärtes Ziel der Ministerin ist, die Energiewende besser mit Kosteneffizienz und Versorgungssicherheit zu verzahnen. Das Gutachten „Energiewende. Effizient. Machen.“ kommt zu dem Schluss, dass dies vor allem durch ein systemdienliches Zusammenspiel von steuerbaren Kraftwerken, erneuerbaren Energien sowie Flexibilitäten wie Stromspeichern und Lasten möglich sein wird. Sowohl der Ausbau der erneuerbaren Energien sei weiterhin notwendig, als auch die verstärkte Nutzung von Flexibilitäten auf Erzeuger- und Verbraucherseite.
In den Handlungsempfehlungen finden sich Vorschläge, die in der Branche bereits thematisiert wurden. Zum Beispiel die Überlegung, dass durch eine gezielte Überdimensionierung von Erzeugungsanlagen gegenüber der Netzanschlusskapazität die Netzinfrastruktur deutlich effizienter genutzt werden könnte. Außerdem sollten sich, schlägt das Gutachten vor, Förder- und Investitionsanreize für erneuerbare Erzeuger, Speicher- und Wasserstofftechnologien nach dem systemisch höchsten Wert von erneuerbarem Strom oder Wasserstoff richten. Nicht zuletzt sollte die Digitalisierung durch einen schnelleren Roll Out von Smart Metern beschleunigt werden, etwa durch mehr Wettbewerb unter den Anbietern und bessere Koordinierung.
Zehn Maßnahmen für eine effizientere Energiewende
Die Ministerin wiederum präsentierte einen Plan mit zehn Maßnahmen, mit denen sie die Energiewende effizienter machen möchte. Dabei gibt es zuweilen Diskrepanzen zu den Ergebnissen des Monitorings. So geht Reiche, anders als die Wissenschaftler, unter dem Stichwort „Planungsrealismus“ von einem Strombedarf am unteren Ende der Skala, also 600 TWh, aus. Es brauche daher Anpassungen bei der Offshore-Kapazität, bei Offshore-Netzanbindungen und Hochspannungs-Gleichstrom-Trassen, so die Ministerin. Zur weiteren Förderung der Erneuerbaren will sie Contracts for Difference einführen.
Zur Stärkung der Versorgungssicherheit sollen noch in diesem Jahr Gaskraftwerke mit der „Umstellungsperspektive auf Wasserstoff“ ausgeschrieben und bis 2027 ein technologieoffener Kapazitätsmarkt eingeführt werden. Um den Wasserstoffhochlauf zu beschleunigen, will Reiche „überkomplexe Vorgaben – wie die strenge Definition von grünem Wasserstoff auf EU-Ebene – abbauen und durch pragmatische Kriterien ersetzen“. Kohlenstoffarmer Wasserstoff (Low-Carbon Hydrogen) soll gleichberechtigt behandelt, CCS/CCU prominent und technologieoffen in den Regulierungsrahmen eingebunden werden.
Das sagt die Branche zum Energiewende-Monitoring
Agora Energiewende: Zentrale Fragen bleiben unbeantwortet
Eine erste Einordnung von Julia Bläsius, Direktorin Agora Energiewende Deutschland, zum heute veröffentlichten Energiewende-Monitoring des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und den daraus abgeleiteten politischen Leitlinien der Bundesregierung:
"Wir begrüßen, dass der Monitoringbericht zur Energiewende Klarheit über den Handlungsbedarf schafft, allerdings lässt die Bundesregierung zentrale Fragen über ihren energiepolitischen Kurs unbeantwortet. Damit fehlt Wirtschaft und Haushalten weiterhin die dringend benötigte Planungssicherheit.
Fest steht: die Entwicklung der Stromnachfrage ist kein Selbstzweck. Eine hohe Stromnachfrage ist Ausdruck einer vitalen Wirtschaft sowie des politischen Willens, die Klimaziele zu erreichen. Annahmen über den künftigen Strombedarf sind damit ein Spiegel der politischen Ambitionen der Bundesregierung bei Zukunftstechnologien. Wie schnell sich eine klimaneutrale Industrieproduktion, Elektrolyseure, Wärmepumpen oder E-Autos etablieren können, hängt – wie auch im Monitoringbericht hervorgehoben – maßgeblich von klima- und industriepolitischen Entscheidungen ab. Diese bestimmen, ob Deutschland sich Wachstumsmärkte sichern kann. Eine konsequente Politik für eine starke Industrie, wachsende Unabhängigkeit von fossilen Energien und das Erreichen der Klimaschutzziele führt nach unseren Berechnungen bis 2030 zu einer Bruttostromnachfrage von rund 700 Terawattstunden.
Den Erneuerbaren-Ausbau auf Basis einer niedrigeren Stromverbrauchsprognose für 2030 zu bremsen, ist kurzsichtig, kostspielig und sendet das falsche Signal an die heimische Wirtschaft. Unabhängig von der Nachfrageentwicklung verteuert ein gedrosselter Zubau von Wind- und Solarenergie den Strompreis 2030 um 2 Cent pro Kilowattstunde – für Haushalte und Unternehmen summieren sich die zusätzlichen Kosten 2030 so auf mindestens 12 Milliarden Euro. Dieser Kurs würde die gerade beschlossene Strompreisentlastung, die das Bundeswirtschaftsministerium mit rund 10 Milliarden Euro Haushaltsmitteln auf 2,4 Cent pro Kilowattstunde beziffert, fast vollständig zunichtemachen.
Anstatt den Rotstift bei den Erneuerbaren Ausbauzielen anzusetzen und so den Strom zu verteuern, sollte die Bundesregierung besser Kostensparpotenziale beim Netzausbau und -betrieb nutzen, um die Strompreise zu senken. Denn unabhängig davon, wie schnell die Stromnachfrage tatsächlich steigt, sichern der konsequente Ausbau Erneuerbarer Energien und ein kosteneffizientes Stromnetz dauerhaft attraktive Strompreise: Davon profitiert die Staatskasse ebenso wie Unternehmen und Haushalte."
Solarwirtschaft warnt vor Förder-Einschnitten
BSW-Solar: Laut Energiewendemonitoring werde zwar der Stromverbrauch nach Einschätzung der Gutachter in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich vorübergehend langsamer wachsen als ursprünglich angenommen. Die Gutachter leiten daraus jedoch nicht die Empfehlung ab, den Ausbau der Solarenergie zu bremsen. Ankündigungen von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, die Förderung neuer Solardächer streichen zu wollen, würden hingegen im Falle einer Umsetzung nach Einschätzung des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW-Solar) unweigerlich darauf hinauslaufen. So würde sich bei Wegfall der EEG-Förderung nach einer Umfrage unter Solarinstallateuren nur noch 4 von 10 Eigenheimbesitzern für die Anschaffung einer Solarstromanlage entscheiden. Hintergrund sind deutlich längere Amortisationszeiten und höhere Kosten bei der Anlagenfinanzierung.
Zur Vorstellung des Monitoring-Berichts erklärt der Hauptgeschäftsführer des BSW-Solar in einer ersten Stellungnahme: „Neue stark wachsende Stromverbraucher wie Wärmepumpen, E-Fahrzeuge, KI-Rechenzentren und Klimageräte werden den Strombedarf künftig stark steigen lassen. Vor diesem Hintergrund muss die Bundesregierung den Ausbau Erneuerbarer Energien und Speichertechnologien jetzt massiv vorantreiben. Anstelle von Einschnitten bei der Solarförderung benötigen Betreiber und Branche einen verlässlichen Investitionsrahmen und weniger Marktbarrieren. Nur so kann Solarenergie den erforderlichen Beitrag zur Umsetzung der Klimaziele leisten und absehbare Zielverfehlungen im Bereich der Windkraft, im Verkehrssektor und bei der Gebäudemodernisierung kompensieren.“
Die Gutachter weisen darauf hin „PV dürfte gemäß der untersuchten Szenarien das EEG-Ziel für 2030 von 215 GW erreichen, bei keinen grundlegenden Änderungen in den Umsetzungsvoraussetzungen wie Flächenverfügbarkeit oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.“ Der BSW-Solar fordert von Bundeswirtschaftsministerin Reiche, auf eine Förderkappung zu verzichten und stattdessen die richtigen Schlussfolgerungen aus dem Monitoring-Bericht zu ziehen. Wie von den Gutachtern des Monitoringberichts herausgearbeitet, böten vor allen Dingen Anreize zur Flexibilisierung sowie eine verbesserte Netzausnutzung Möglichkeiten, die Kosteneffizienz der Energiewende zu erhöhen.
GIH: Handlungsdruck – Energiewende muss effizienter werden
Anlässlich des gestern Monitoringberichts zur Energiewende fordert der Bundesverband für Energieberatende (GIH) eine stärkere Fokussierung auf Effizienz, Speicher und Flexibilität. Der GIH-Vorsitzende, Stefan Bolln, äußert dazu:
„Im Bericht wird deutlich: Der reine Ausbau von Wind- und Solarenergie reicht nicht aus. Wir müssen Spitzenlasten im Stromnetz senken und weiterhin auch die Gebäudesanierung sowie industrielle Effizienzmaßnahmen verlässlich fördern.“ Zentrale Beiträge können dabei gut gedämmte Gebäude mit Wärmepumpen leisten, die Lastspitzen durch flexible Steuerung abfedern. Ebenso schlägt der GIH eine gezielte Förderung von Stromspeichern mit Netzdienlichkeitspflichten vor – insbesondere bei Eigenheimbesitzerinnen und Eigenheimbesitzern, die eine Schlüsselrolle für die Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung spielen.
Mit Blick auf die Versorgungssicherheit toleriert der GIH den Ausbau der Gaskraftwerke als Brücke für den Kohleausstieg. Vor Ausschreibungen von mehr als zehn Gigawatt müsse jedoch der Einsatz von Biomasse und Batterien für Dunkelflauten wirtschaftlich geprüft und vorrangig genutzt werden. „Entscheidend ist, dass die Energiewende kosteneffizient und systemdienlich umgesetzt wird. Dafür braucht es Forschung, Digitalisierung und klare Leitmärkte für Erneuerbare und deren Produkte“, betont Bolln.
DUH: : Fossile Agenda statt echtem Realitätscheck
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert das Energiewende-Monitoring als Ausdruck von Ministerin Reiches fossiler Agenda. Dazu Sascha Müller-Kraenner, DUH-Bundesgeschäftsführer:
„Mit den Schlüssen, die Frau Reiche aus dem Energiewende-Monitoring zieht, bürdet sie unserer Energieversorgung eine schwere Hypothek auf. Heute ist überdeutlich geworden, dass Bundeswirtschaftsministerin Reiche weiter auf die verkürzten Vorschläge der Gaslobby baut. Das Energiewende-Monitoring wäre die Chance, einen wissenschaftlich fundierten Rahmen für die Energiewende zu schaffen. Stattdessen hat die Ministerin die Empfehlungen des Gutachtens offenbar nicht sorgfältig gelesen und vertritt ihre vorgefasste Meinung. Was Frau Reiche mit ‚Planungsrealismus‘ meint, ist faktisch eine Ausbau-Bremse für die Erneuerbaren, der ‚technologieoffene Kapazitätsmarkt‘ ist ein Einfallstor für neue fossile Abhängigkeiten. Eine sichere, bezahlbare und klimafreundliche Energieversorgung gelingt nicht mit fossiler Überkapazität in Form von unzähligen Gaskraftwerken. CCS/CCU als Klimaschutztechnologie zu verkaufen ist brandgefährlich – und das angebliche ‚Subventionen senken‘ läuft in Wahrheit auf den Kahlschlag bei wichtigen Förderprogrammen hinaus, während fossile Beihilfen neu geschaffen werden sollen.“
DENEFF: Ohne Energieeffizienz ist die Energiewende im Blindflug.
Aus Sicht der DENEFF greift der Bericht entscheidend zu kurz: Energieeffizienz, der wesentliche Baustein für die Entwicklung des Energie- und Strombedarfs und der zentrale Hebel, um die Energiewende tatsächlich kosteneffizient zu gestalten, wird zwar als wichtig anerkannt, wird aber wie eine unbekannte Größe behandelt. Die Potenziale werden weder beziffert noch bei den Handlungsempfehlungen systematisch berücksichtigt. Damit liefert der Bericht selbst das deutlichste Signal: Ohne eine konsequente Ausrichtung auf Energieeffizienz wird die Energiewende unnötig teuer, riskant und langsam.
Der Bericht erkennt an, dass Gebäudesanierungen und Energieeffizienz eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des Strombedarfs spielen. Gleichzeitig heißt es aber ausdrücklich, dass das Energieeffizienzgesetz nicht Gegenstand der Untersuchung ist. Damit bleibt Effizienz in den Szenarien eine große Unbekannte – statt eine klar bezifferte Ressource.
An einer der wenigen Stellen, an denen der Bericht Energieeffizienz erwähnt, wird sogar behauptet, dass Effizienz den Ausbau der Erneuerbaren hemmen könne – allerdings ohne Belege. Tatsächlich zeigen aktuelle Daten und Studien das Gegenteil: Laut Umweltbundesamt hätte der Anteil erneuerbaren Stroms 2024 ohne Effizienzgewinne nur bei 41,3 % statt bei 54,4 % gelegen – 13 Prozentpunkte niedriger.
Mit dem Monitoringbericht wurde also eine unvollständige Analyse der Energiewende vorgelegt. Weil Energieeffizienz darin nur als „unbekannte Größe“ behandelt wird, bleibt die Perspektive unvollständig.
Auch andere Verbände äußerten hingegen Kritik. „Die starke Fokussierung auf Kostenminimierung lässt vollkommen außer Acht, dass die Energiewende ein gesamtgesellschaftliches Projekt ist“, sagte Katharina Habersbrunner, Vorständin des Bündnis Bürgerenergie. „Wenn Kommunen, Gewerbe und der Bürgerschaft nun suggeriert wird, dass weitere Erneuerbare-Energie-Projekte nicht mehr benötigt werden, wird das die Energiewende auf Jahre ausbremsen“, so Habersbrunner mit Blick auf die niedrigere Stromprognose.
Thomas Losse-Müller, Co-Direktor der Stiftung Klimaneutralität, warf der Ministerin vor, auf das falsche Ziel zu fokussieren. „Es geht nicht primär um den Anteil der Erneuerbaren im Energiesystem, sondern um die Erreichung der Klimaziele.“ Eine langsamer steigende Stromnachfrage spreche eher dafür, die Elektrifizierung von Industrie, Verkehr und Gebäuden voranzubringen und den Anteil der Erneuerbaren an der Stromerzeugung schneller zu erhöhen, statt am 80-Prozent-Ziel festzuhalten.
BEE: Energiewende systemdienlich weiterentwickeln
Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energien (BEE), sieht sich durch das Monitoring bestätigt. „Das Gutachten zeigt: Es braucht keine Neuausrichtung der Energiewende, sondern sie muss systemdienlich weiterentwickelt werden“, so Peter. Vieles von dem, was das Gutachten fordere, etwa die Überbauung der Netzanschlüsse und die verstärkte Nutzung von Flexibilitäten, habe der BEE bereits in seiner Studie „Klimaneutrales Stromsystem“ vorgeschlagen.
BWO: Wichtiger Schritt zu mehr Transparenz
Der Bundesverband Windenergie Offshore (BWO) begrüßte ausdrücklich die angekünigte Einführung von CfDs und forderte, dass diese bereits für die kommenden Auktionen im Jahr 2026 angewendet werden. Dass die Ministerin erkläre, dass das Ziel von 30 GW Offshore 2030 nicht zu halten sei, nannte der Verband einen wichtigen Schritt zu mehr Transparenz. „Jetzt gilt es, Ertragsziele der Offshore-Windparks vor reine Leistungsziele zu stellen. Nur wenn Windparks auf See effizient und ertragreich betrieben werden können, leisten sie einen stabilen Beitrag zur Versorgungssicherheit und ermöglichen weitere Investitionen“, erklärte BWO-Geschäftsführer Stefan Thimm.
BDEW: Monitoringbericht ist überzeugender Angang
Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung: „Der Monitoringbericht ist ein überzeugender Angang, der vieles wiedergibt, was wir bereits vorbereitet haben: Der Ausbau der Erneuerbaren muss mehr mit den Netzen in Einklang gebracht werden. Der Zubau von Gaskraftwerken, die auf H2 umgestellt werden können, die Ausgestaltung eines technologieoffenen Kapazitätsmarkts bereits bis 2027 sowie den Hochlauf unterstützender Regulierung für Wasserstoff sind allesamt richtige Punkte.
Vor diesem Hintergrund erwarten wir in den nächsten Wochen und Monaten eine enge Einbeziehung der Branche bei der Ausgestaltung der Schlussfolgerungen des Monitorings.
Um die Handlungskraft der Unternehmen zu stärken, müssen die überbordende Bürokratie verschlankt und die Digitalisierung vorangetrieben werden.
Der nun mit 600 bis 700 TWh prognostizierte Strombedarf ist eine gute Standortbestimmung, am Ende aber auch nur eine Momentaufnahme. Die Elektrifizierung von Verkehr, Wärme und Industrie entwickelt sich aktuell zwar langsamer als angenommen, dennoch sollte man vorbereitet sein auf anwachsende Stromnachfrage durch die erhoffte konjunkturelle Erholung und auf neue und zusätzliche Stromnachfrage u.a. durch Elektrolyseure, Rechenzentren, die E-Mobilität und die Wärmeversorgung.
Am erheblichen Ausbaubedarf Erneuerbarer Energien ändert sich aus Sicht der Energiebranche nichts. Berücksichtigt man die Volllaststunden der Erneuerbaren, so erreicht man im Jahr 2030 mit den jetzigen Ausbauzielen einen Anteil von 80 Prozent Erneuerbaren bei einem Stromverbrauch von 620 TWh - und nicht von 750 TWh. Der aktuelle Ausbaupfad beschreibt also eine „sowieso“-Notwendigkeit. Um diese Ziele zu erreichen, dürfen wir jetzt nicht im Tempo nachlassen. Es bleibt wichtige Aufgabe der Bundesregierung, die Planung und Genehmigung zu beschleunigen. So begrüßen wir ausdrücklich die Ankündigung, RED III zügig umzusetzen. Die Unternehmen brauchen einen verlässlichen Kurs, Planungs- und Investitionssicherheit.
Richtigerweise benennt das Monitoring die Notwendigkeit, System- und Kosteneffizienzpotenziale zu erkennen und zu heben. Durch eine stärkere Fokussierung auf Systemeffizienz lässt sich die Energiewende günstiger und zugleich stabiler gestalten. Die Finanzierbarkeit des Netzausbaus ist richtigerweise benannt worden. Der Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur sind der Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts. Ein „Deutsche-Bahn-Effekt“ – zu spät oder zu wenig in die Infrastruktur zu investieren – darf uns nicht passieren.“