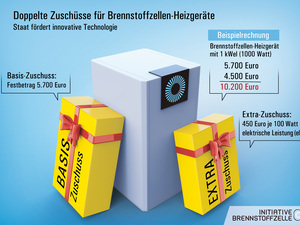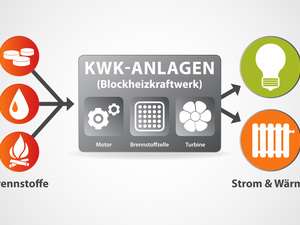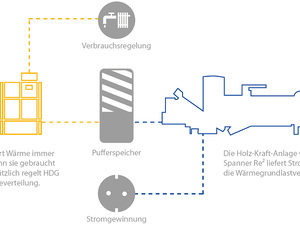Teure kalte Nahwärme in Tübingen: Schlechtes Beispiel einer guten Sache
Immer mehr Städte setzen auf kalte Nahwärme als klimafreundliche Lösung der Zukunft. Richtig geplant kann sie ganze Quartiere effizient und emissionsarm versorgen. Doch das Beispiel aus Tübingen zeigt, was passiert, wenn Kosten, Verträge und Nutzerinteressen aus dem Gleichgewicht geraten. Für viele Bewohner wird das ökologische Vorzeigeprojekt zur teuren Belastung.
Tübingen: Wenn die Wärmewende zur Kostenfalle wird
So zum Beispiel im Fall der von teurer Nahwärme betroffenen Wärmekunden im Tübinger Neubaugebiet "Oberer Kreuzäcker", über den der SWR auf tagesschau.de berichtete. Die an das Nahwärmenetz zwangsläufig angeschlossenen Kunden klagen über 60 Prozent gestiegene Grundkosten, deutlich teurer als ursprünglich im Jahr 2021 von den Tübinger Stadtwerken (SWT) genannt.
Zudem sind sie verpflichtet, zehn Jahre lang an das Wärmenetz angeschlossen zu bleiben und dürfen ihren selbst erzeugten Photovoltaik-Strom in dieser Zeit nicht für die eigene Wärmeversorgung nutzen.
Die Stadtwerke bestätigten die Preiserhöhungen als "wirtschaftlich notwendig". Paradox in diesem Zusammenhang: Noch im November 2024 wurde die Universitätsstadt Tübingen von der Agentur für Erneuerbare Energien als Energie-Kommune des Monats ausgezeichnet.
Warum ist die kalte Nahwärme so teuer?
Die hohen Kosten der kalten Nahwärme in Tübingen-Bühl haben mehrere Ursachen – sowohl strukturelle als auch äußere:
1. Unerwartete Preissteigerungen
Ursprünglich kommunizierten die Stadtwerke Tübingen (swt) einen jährlichen Grundpreis von rund 1.317 Euro. Kurz vor Inbetriebnahme des Netzes Ende 2023 stieg dieser jedoch auf 2.133 Euro, also um etwa 60 Prozent. Dadurch tragen Haushalte nun Fixkosten von über 2.000 Euro jährlich, zusätzlich zum Strom für die Wärmepumpen und einem einmaligen Baukostenzuschuss von rund 12.000 Euro.
2. Hoher Grundpreisanteil
Laut Anwohnern macht der Grundpreis etwa 80 Prozent der jährlichen Gesamtkosten aus. Das bedeutet, dass selbst energieeffizientes Verhalten oder sparsames Heizen kaum Einsparpotenzial bietet.
3. Gründe laut Stadtwerke
Die Stadtwerke verweisen auf deutlich gestiegene Bau- und Energiekosten:
- Der Baukostenindex sei seit 2021 um etwa 35 Prozent gestiegen.
- Die Strombeschaffungskosten hätten sich infolge des Ukraine-Kriegs um 82 Prozent erhöht.
Diese externen Faktoren hätten die ursprünglich geplanten Preise hinfällig gemacht; man habe die Preisanpassung über vertragliche Preisgleitklauseln vorgenommen, um kostendeckend arbeiten zu können.
4. Vertragsbindung und Nutzungseinschränkungen
Die Anwohner sind mindestens zehn Jahre an die Stadtwerke gebunden und dürfen während dieser Zeit keinen selbst erzeugten Solarstrom zum Heizen verwenden. Trotz Solarpflicht auf neuen Dächern müssen sie den Strom für ihre Wärmepumpen teurer von den Stadtwerken beziehen – ein weiterer Kostentreiber.
Fehlende Transparenz und rechtliche Schritte
Viele Bewohner fühlen sich überrumpelt, da die ursprünglichen Preise nur als „unverbindliche Richtwerte“ bezeichnet wurden. Rund 30 Eigentümer haben sich daher zusammengeschlossen und die Energiekartellbehörde Baden-Württemberg eingeschaltet. Eine Entscheidung steht noch aus.
Das Projekt zeigt letztlich, wie ökologische Innovationen an wirtschaftlicher Akzeptanz scheitern können, wenn Kosten und Flexibilität aus Sicht der Nutzer nicht stimmen.
Kritik an Monopolstrukturen und fehlender Wirtschaftlichkeit
Aus Sicht der Allianz Freie Wärme ist dies kein Einzelfall: Wenn Wärmenetz-Projekte zu einem faktischen Monopol führen, sind sie häufig weder realistisch noch nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen geplant.
„Für die Kunden ist der Ärger erst einmal groß, weil sie neben den hohen Kosten im Normalfall auch aus den Knebelverträgen mit langen Vertragslaufzeiten nicht rauskommen“, erklärt Benjamin Schaible, Obermeister der SHK-Innung Tübingen.
Gründe und Ursachen für solche Negativbeispiele sind aus Sicht der Freien Wärme häufig Planungen ohne tragfähige marktwirtschaftliche Vergleiche mit flexiblen, dezentralen Lösungen sowie lange Vertragslaufzeiten ohne Kündigungsrechte. Die finanziellen Folgen tragen die Verbraucher.
Mehr über den Fall Tübingen erfahren Sie in diesem Beitrag der Tagesschau.