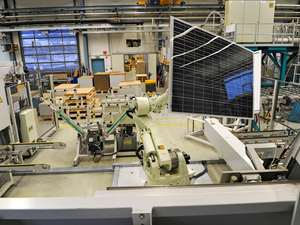Rückzahlung von Corona-Hilfen: Die wichtigsten Infos für Betriebe

Im Herbst 2024 erhalten zahlreiche Unternehmen Schlussbescheide zu den Corona-Überbrückungshilfen. Diese Bescheide fordern häufig eine Rückzahlung der Hilfen.
Stefan Schwindl von der MTG Wirtschaftskanzlei und Dr. Elske Fehl-Weileder von Schultze & Braun erläutern, welche Rechte und Pflichten betroffene Unternehmen haben und welche Aspekte bei der Rückabwicklung beachtet werden sollten.
Rückzahlungsforderungen nach der Schlussabrechnung
Die Verpflichtung zur Rückzahlung ergibt sich laut Schwindl und Fehl-Weileder insbesondere dann, wenn der tatsächliche Corona-bedingte Umsatzausfall geringer ausfiel als ursprünglich bei der Antragstellung angenommen. Unternehmen müssen im Rahmen der Schlussabrechnung nachweisen, dass der Umsatzrückgang tatsächlich auf die Pandemie zurückzuführen war. Wird dieser Nachweis von der Bewilligungsstelle nicht anerkannt, greifen strikte Regelungen: „Die Folge ist, dass das Unternehmen die erhaltenen Überbrückungshilfen in voller Höhe zurückzahlen muss“, so die Experten. Eine Teilrückzahlung ist in solchen Fällen ausgeschlossen.
Auch Unternehmen, die die Frist für die Schlussabrechnung versäumt oder diese gar nicht eingereicht haben, sind verpflichtet, die Hilfen vollständig zurückzuzahlen.
Das sind die Zahlungsfristen und Möglichkeiten zur Stundung
Laut Fehl-Weileder und Schwindl müssen Unternehmen die geforderten Rückzahlungen innerhalb von sechs Monaten nach Zugang des Schlussbescheids leisten. Es besteht jedoch die Option, Stundungs- oder Ratenzahlungsvereinbarungen zu treffen. Diese können in der Regel für bis zu 24 Monate, in Einzelfällen sogar bis zu 36 Monate vereinbart werden.
Rechtsmittel gegen den Schlussbescheid
Unternehmen haben grundsätzlich die Möglichkeit, gegen einen Schlussbescheid mit einer Rückzahlung Widerspruch einzulegen oder zu klagen. Die Erfolgsaussichten solcher Verfahren sind jedoch derzeit schwer einzuschätzen, da es bislang nur wenige gerichtliche Entscheidungen gibt. Besonders für Unternehmen mit ohnehin angespannter Liquiditätslage empfiehlt sich eine genaue Prüfung, ob das eingelegte Rechtsmittel eine aufschiebende Wirkung hat, so die Experten.
„Eine solche Wirkung haben etwa ein Widerspruch oder eine Anfechtungsklage. Die Rückzahlungsforderung kann dann bis zur gerichtlichen Entscheidung über den Schlussbescheid von den Bewilligungsstellen nicht vollstreckt werden. Zudem führt die aufschiebende Wirkung dazu, dass der zurückzuzahlende Betrag bei der Prüfung der Frage 'Ist mein Unternehmen noch zahlungsfähig?' zunächst nicht einbezogen werden muss“, erläutern Fehl-Weileder und Schwindl.
Finanzielle Planung und Insolvenzantragspflicht
Auch bei aufschiebender Wirkung bleibt die Rückzahlungsforderung bestehen. Unternehmen müssen den vollständigen Rückzahlungsbetrag in ihrer Finanzplanung berücksichtigen. Die Experten weisen darauf hin, dass Unternehmen, bei denen absehbar ist, dass ihnen, etwa nach einer gerichtlichen Bestätigung der Rückzahlungspflicht, die liquiden Mittel für die Rückzahlung fehlen, mit der rückfordernden Stelle eine Lösung finden müssen.
„Gelingt ihnen das nicht, kann es sein, dass ein Unternehmen durch die Verpflichtung zur Rückzahlung von Überbrückungshilfen zahlungsunfähig wird und/oder in eine Überschuldungssituation gerät“, warnen Fehl-Weileder und Schwindl.
Die Geschäftsleitung muss in einem solchen Fall innerhalb der gesetzlichen Fristen einen Insolvenzantrag zu stellen, um persönliche Haftungsrisiken zu vermeiden. Seit Anfang 2024 gilt die Insolvenzantragspflicht wieder uneingeschränkt. Maßgeblich ist, ob das Unternehmen seine fälligen Verbindlichkeiten noch bedienen kann.
Individuelle Prüfung im Einzelfall empfohlen
„Es zeigt sich, dass im Zusammenhang mit einem Schlussbescheid für Corona-Hilfen jeder Fall individuell betrachtet werden sollte – gerade, da dabei viele Faktoren eine Rolle spielen“, fassen Fehl-Weileder und Schwindl zusammen. Sie raten, bei Rückforderungsbescheiden und deren möglichen Konsequenzen fachliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen, insbesondere im Hinblick auf die Insolvenzantragspflicht.