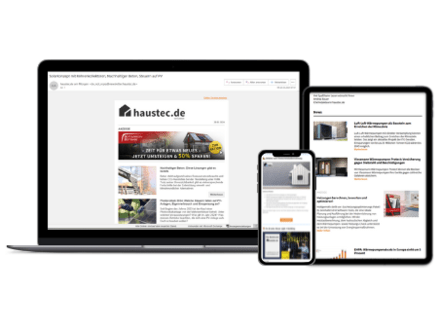Forschungsprojekt in Hessen: Wie effizient laufen Wärmepumpen in der Praxis?
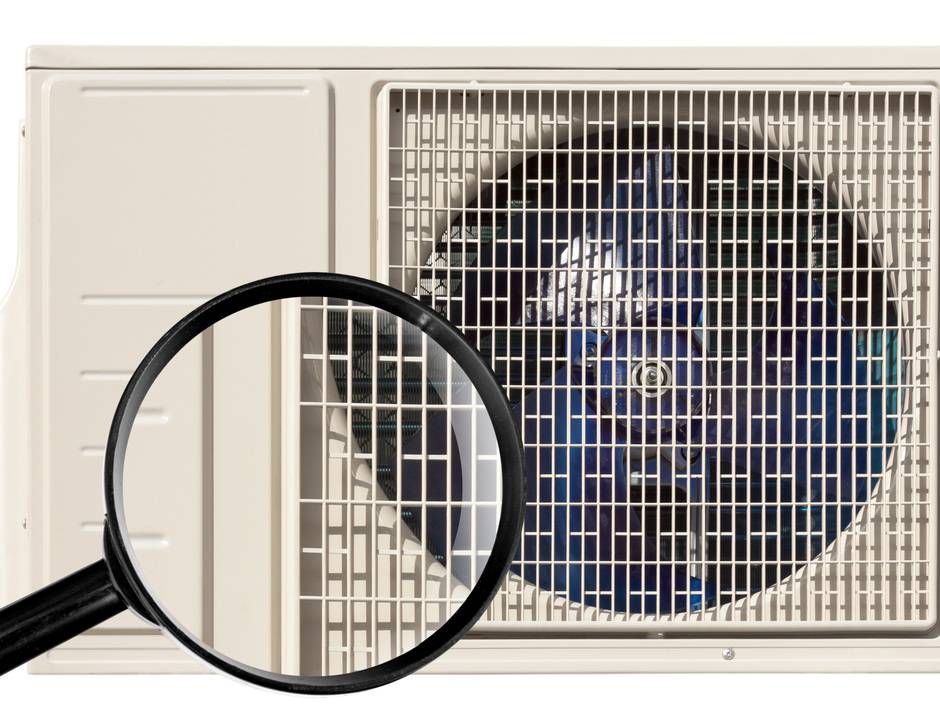
Das Institut für Wohnen und Umwelt in Darmstadt hat nun den Endbericht zum Forschungsvorhaben veröffentlicht, sowie eine Broschüre für Endverbraucher. Das Ingenieurbüro für Wärmepumpensysteme von Hans-Jürgen Seifert war als externer Experte und gibt hier einen Überblick und eine Einschätzung der gewonnen Erkenntnisse.
In den letzten Jahren wurden zahlreiche Studien zum Einsatz von Wärmepumpe in Deutschland und Europa veröffentlicht. Am bekanntesten sind sicherlich die Studien vom Fraunhofer ISE.
Das vom Land Hessen geförderte Forschungsprojekt unterscheidet sich jedoch in einigen Punkten von den bisherigen Studien und weißt interessante Ansätze auf, welche für zukünftige Wärmepumpen-Investoren besonders hilfreich sein können. Um bestehende Vorurteile und Hürden abzubauen, wurde das Projekt „Wärmepumpenpraxis im Hessischen Wohngebäudebestand“ vom IWU initiiert und vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlicher Raum gefördert. Es wurden Jahresarbeitszahlen bei 47 Ein- und Zweifamilienhäusern sowie einem Mehrfamilienhaus über zwei Jahre erfasst.
Schwerpunkte: Sanierungsgrad der Gebäude und Heizflächen
Bemerkenswert ist, dass die Hauptakteure des Projektes besonderes Augenmerk auf den Zustand der Gebäudehülle (Sanierungsgrad) und den verschiedenen Wärmeübergangssystemen (Heizkörper, Flächenheizung) legten. In den letztendlich 48 von 71 angefragten Objekten waren fast alle in Frage kommenden Gebäude-Baualtersklassen vertreten (bis zu über 100 Jahre alte Gebäude).
Hier nun eine Schwerpunktanalyse über die ausgewerteten Ergebnisse und die daraus eventuell zu ziehenden Schlussfolgerungen.
- Grundsätzlich ist es möglich Wärmepumpen sowohl in älteren Gebäuden, als auch bei nur mit Heizkörpern ausgestatteten Räumen einzusetzen. Das deckt sich mit den bereits veröffentlichen Studien zum Einsatz von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden.
- Es wurden unsanierte, teilsanierte und vollsanierte Gebäude berücksichtigt und entsprechend dem Sanierungsstand mögliche Szenarien untersucht und simuliert.
- Bei den Untersuchungen der Heizflächen wurde nach nur mit Heizkörpern ausgestattet, Heizkörper gemischt mit Fußbodenheizung und reine Fußbodenheizung unterschieden.
- Bei der Befragung der Betreiber wurde der Schwerpunkt auf Kenntnisse über die Bedienung und Möglichkeiten der Wärmepumpenregelung zur Optimierung der Wärmepumpenanlage einschließlich Datenauswertung gelegt.
- Es wurden die Unterschiede zwischen Luft-Wärmepumpen und Erdwärmepumpen deutlich herausgearbeitet.
- Bei den Luft-Wärmepumpen wurde Geräuschbeeinträchtigungen differenziert nach eigenem Lärmempfinden, nach Auswirkungen auf die Nachbargebäude und nach Wahrnehmung durch die Nachbarn herausgearbeitet.
- Was das Verhalten und die Gewohnheiten der Betreiber der Wärmepumpe betrifft, so wurden die Unterschiede in der Betriebsweise, der Warmwasserbereitung und die Nutzung weiterer Wärmequellen und PV- Anlagen bezüglich Eigenverbrauch ausführlich analysiert.
- Bei bivalenten Wärmepumpenanlagen konnte nachgewiesen werden, dass bei mindestens zwei Anlagen ein monoenergetischer Betrieb auch möglich gewesen wäre. Geht man davon aus, dass schrittweise weitere Verbesserungen an der Gebäudehülle erfolgen, können dann monoenergetische und bivalente Anlagen zukünftig eventuell monovalent betrieben werden.
- Im Forschungsbericht wurden auch mögliche Szenarien klimabedingter Entwicklungen untersucht.
Auffällig sind im Projekt bei der Datenerfassung und den Vorort-Begehungen, dass im Bundesland Hessen zumindest während der Laufzeit des Projektes kaum tiefe Außentemperaturen während der Heizperiode zu verzeichnen waren (Tiefstwerte maximal -5°C). Da der Verfasser des Artikels in einer der kältesten Klimaregion unseres Landes beheimatet ist (Tiefsttemperaturen unter -20°C sind nicht außergewöhnlich) kommt er nicht umhin, ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass deshalb nicht alle im Forschungsprojekt gewonnen Erkenntnisse eins zu eins auf andere Regionen übertragen werden können. Das trifft vor allem für die Leistungs- und COP-Kurven in Abhängigkeit von Außen- und Vorlauftemperaturen sowie die Einsatzgrenzen der Luft-Wärmepumpen zu. - Die gemeinsamen Vorortbegehung im Januar 2025 haben u.a. folgende wertvolle Erkenntnisse ans Tageslicht befördert:
Die Betreiber haben sich relativ tief mit den Besonderheiten der Wärmepumpen und ihren Einflussfaktoren auseinandergesetzt und auch während der Laufzeit des Projektes alle möglichen Optimierungspotenziale erschlossen. Es ging teilweise soweit, dass Effizienz über Hygieneanforderungen gestellt wurden (WW-Solltemperatur 43°C (Empfehlung für das EFH 50°C und Legionellenschaltung).
Bei einem Teilnehmer konnte kein Optimierungspotenzial mehr gefunden werden. Er begründete dies damit, dass er sich das Buch „Effizienter Betrieb von Wärmepumpenanlagen“ vor Beginn der Maßnahme gekauft und alle Punkte zur effizienten Planung, Installation und Betrieb einer Wärmepumpenanlage abgearbeitet hat.
Die Datenerfassung wurde ausführlich und mit hoher Fachkompetenz durchgeführt. Die Teilnehmer der Studie zeigten großes Interesse und nutzten teilweise die Gelegenheit aus der Datenerfassung entsprechende Rückschlüsse zu ziehen und ihre Anlagen zu optimieren. Bei den Herstellern gab es unterschiedliche Bereitschaft erforderliche Daten bereitzustellen, bzw. zu interpretieren. Auffällig dabei war, dass es zwischen den Daten aus den Wärmepumpenreglern und den Daten aus Wärmemengen- und Stromzählern der Betreiber unterschiedliche Bilanzgrenzen gab. Diese wurden – soweit möglich – entsprechend umgerechnet.
Wo lagen die Jahresarbeitszahlen?
Die Ergebnisse zeigen, dass Wärmepumpen auch in älteren Gebäuden mit konventionellen Heizsystemen zuverlässig und effizient arbeiten können. Die Jahresarbeitszahlen (JAZ) lagen für Luft-Wasser-Wärmepumpen bei Heizkörpern im Mittel bei 3,1, mit Fußbodenheizungen bei 3,7. Erdreich-Wärmepumpen erzielten mit durchschnittlich 4,7 die höchsten Werte. Besonders positiv wirkten sich niedrige Vorlauftemperaturen und der Austausch einzelner Heizkörper zur Absenkung der Vorlauftemperatur auf die Effizienz aus.
Durchschnittliche Gesamtkosten der Wärmepumpenanlagen
Die Kostenanalyse auf Basis von 39 Anlagendatensätzen ergab durchschnittliche Gesamtkosten von rund 30.100 Euro. Luft-Wasser-Wärmepumpen lagen bei etwa 29.700 Euro, Erdreichanlagen bei 27.500 Euro (ohne Quellenerschließung) und bivalente Systeme bei rund 34.300 Euro. Zwischen 2017 und 2023 stiegen die mittleren Anlagenkosten um etwa 6.000 Euro. Unterschiedliche Installationsbedingungen, Elektroarbeiten und zusätzliche Maßnahmen wie der Heizkörpertausch beeinflussten die Gesamtkosten erheblich.
Was sagen die Eigentümer der Wärmepumpen?
Die begleitende Befragung der Eigentümerinnen und Eigentümer zeigte ein hohes Maß an Zufriedenheit: Rund 90 Prozent sind mit Funktion und Betrieb ihrer Wärmepumpen zufrieden. Entscheidende Beweggründe für den Umstieg waren Klimaschutz, Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und die Möglichkeit, die Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage zu kombinieren. Kurzfristige wirtschaftliche Aspekte standen nicht im Vordergrund.
Wo schlummern Optimierungspotenziale?
Gleichzeitig wurden Optimierungspotenziale identifiziert: Nur bei rund 60 Prozent der Anlagen wurde eine Heizlastberechnung durchgeführt, und bei etwa der Hälfte erfolgte ein hydraulischer Abgleich. Häufig fehlten zudem eine ausreichende Einweisung in die Bedienung sowie eine intuitive Steuerung der Anlagen.
Funktionen zur Eigenstromverwendung oder zu dynamischen Stromtarifen blieben weitgehend ungenutzt.
Vor-Ort-Untersuchungen einzelner Anlagen zeigten, dass durch angepasste Heizkurven, optimierte Zeiten zur Warmwasserbereitung und eine bessere Dämmung der Rohrleitungen weitere Effizienzsteigerungen möglich sind.
Lock in-Effekte bei Heizungsmodernisierung vermeiden
Die Untersuchungen im Gesamtenergiesystem zeigen, dass der frühzeitige Einsatz von Wärmepumpen auch in unsanierten Gebäuden zu einer deutlichen Reduktion der Treibhausgasemissionen beitragen kann und zugleich Lock in-Effekte durch erneute Heizkesselinvestitionen vermeidet. Systemanalysen unter zukünftigen Stromerzeugungsbedingungen mit hohen Anteilen fluktuierender erneuerbarer Energien verdeutlichen zudem, dass pauschale CO₂-Emissionsfaktoren für Strom häufig keine sachgerechte Bewertungsgrundlage mehr darstellen und dass bivalente Wärmepumpensysteme im Gesamtsystem ähnlich vorteilhaft abschneiden können wie monovalente Systeme.
Fazit: Was braucht es für eine effiziente Wärmepumpenanlage?
Das Forschungsprojekt „Wärmepumpenpraxis im hessischen Wohnungswärmepumpenbestand" ist eine wertvolle Ergänzung bereits bestehender Untersuchungen zum Einsatz von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden. Die gewonnen Erkenntnisse können bis auf wenige Ausnahmen direkt auf die anderen Bundesländer übertragen werden. Dies hilft Vorurteile abzubauen, den Einsatz von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden zu beschleunigen und vor allem Optimierungspotentiale bei den bestehenden und bei den neu zu errichtenden Anlagen im beträchtlichen Umfang zu erschließen.
Eine effiziente Wärmepumpenanlage kann nur im abgewogenen Zusammenspiel zwischen dem Grad der Gebäudesanierung, der Optimierung der Heizflächen auf niedrige Vorlauftemperaturen, einer Wärmepumpe mit hohem Gütegrad und (COP/SCOP), einer sauberen Auslegung und Installation mit effizienter Hydraulik und hydraulischem Abgleich, der optimalen Einstellung des Wärmepumpenreglers, der regelmäßigen Kontrolle der Jahresarbeitszahl (JAZ) sowie einem abgestimmten und bewussten Betreiberverhalten erreicht werden.
Hans-Jürgen Seifert ist Dipl.-Ing. (FH) für Luft- und Kältetechnik. Er ist Inhaber eines Ingenieurbüros für Wärmepumpensysteme und rationelle Energieanwendung und erstellt als Privat- und Gerichtssachverständiger Gutachten zu Wärmepumpenheizungsanlagen. Er ist außerdem Autor mehrerer Sachbücher.
Link zum Endbericht: https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/energie/2025_IWU_Swiderek-et-al_WP-Hessen_20251014.pdf
Link zur Hauseigentümerbroschüre: https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/energie/2025_Swiderek_et_al_Broschuere-WP-Bestand.pdf
Lesen Sie hierzu auch: