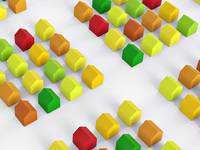So ist der Wärmepumpeneinsatz im Bestand machbar
Technisch wäre das aufgrund der hohen Heizlast von etwa 40.000 kWh/a eigentlich nicht wirklich machbar und sinnvoll gewesen. Vor allem, weil über die Jahre gleichzeitig die ursprünglich für eine Einrohrheizung ausgelegte Hydraulik „mitgewachsen“ ist.
Nach intensiver Detailplanung und genauer Wärmebedarfsberechnung ging es doch und die Umwelt wurde um mehr als 4.500 l Öl pro Jahr entlastet. Möglich machten das eine Wärmepumpen-Kaskade mit 2 x 10 kW Leistung, eine PV-Anlage mit 9,2 kWp auf dem Dach und ein 8 kWh-Batteriespeicher im Keller sowie ein auf das Gesamtpaket abgestimmter Pufferspeicher. Diese Anlagenkombination wurde auf der Basis exakter energetischer Eckdaten und Verbrauchsprofile individuell passend auf das Objekt zugeschnitten.

Nachhaltigkeit gefordert
Das vorhandene Ölbrennwertgerät im Münchener Vorort Olching war noch gar nicht so alt. Aber es gab aufgrund des gestiegenen Hochwasserrisikos am Standort eine latente Umweltgefahr durch die fünf 1.000-l-Öltanks im Keller. Zudem war der Kunde ökologisch orientiert und investiert daher kontinuierlich in die regenerative Energie- und Wärmeversorgung, weil er aus bauphysikalischen Gründen die Fassade nicht abdichten will. Kontinuierlich investieren bedeutet in diesem Fall: Das Dach ist bereits gedämmt, die Fenster sind ausgetauscht, eine knapp 50 m² große PV-Anlage inklusive Batteriespeicher für den Eigenverbrauch schon installiert.
Dass eine Wärmepumpe zunächst theoretisch geeignet war, um im nächsten Schritt den CO2-Ausstoß nach unten und den PV-Strom-Eigenbedarf weiter nach oben zu bringen, war naheliegend. Gleichzeitig wollte die Familie aber keinesfalls auf den gewohnten Versorgungskomfort verzichten – von der Raumwärme selbst in kalten Wintern bis zum Warmwasserbedarf eines gehobenen Zweifamilienhauses. Bei aller ökologischen Grundüberzeugung sollte das Projekt außerdem noch wirtschaftlich darstellbar bleiben.

Auswahl der Wärmepumpe
Durch die vorhandene PV-Anlage mit dem entsprechenden Stromertrag war der Einbau einer Wärmepumpe eine nahe liegende Lösung. Die erste Frage war dann aber: Sollte es eine Sole-/Wasser-Variante werden, aufgrund des hohen Grundwasserspiegels? Oder doch besser eine Luft/Wasser-Ausführung? Und Frage Nummer zwei: Wie ist das mit der Heizlast vereinbar? Denn das Gebäude aus den 60er-Jahren hat auf drei Etagen immerhin rund 240 m² Wohnfläche.
Frage Nummer 1 war schnell beantwortet. Denn allein durch den geringeren Installationsaufwand war eine Luft-/Wasser-Wärmepumpe als Zweier-Kaskade für den Heizungsbauer im Grunde von Anfang an gesetzt. Denn über die Kaskadierung und die mögliche Vorlauftemperatur von 55 °C ist eine solche Anlage für Bestandsobjekte gut geeignet. Noch bis vor etwa fünf Jahren war das sicherlich anders: Um die Wärmeleistung zu erreichen, hätte man dann auf jeden Fall zu einer Wasser-/Wasser- oder Sole-/Wasser-Variante greifen und die Kosten für die Erdarbeiten, wie zum Beispiel einen Kollektorkorb, in Kauf nehmen müssen.
Durch die neue Generation Luft-/Wasser-Anlagen ist eine solche Lösung nun nicht mehr notwendig. Zudem arbeiten die hier installierten Luft/Wasser-Wärmepumpen aroTherm plus von Vaillant modulierend, was eine Anpassung der Heizleistung an den Gebäudewärmebedarf erleichtert. Denn das erklärte Ziel ist für den Heizungsbaumeister und seine Mannschaft bei solchen Bestandsanlagen eine Vor-/Rücklauf-Differenz von 10 K, um die Effizienz der Wärmepumpe bestmöglich auszunutzen.
Wärmebedarfsrechnung essentiell
Allerdings waren die 30 kW installierte Leistung der Ölheizung zumindest zunächst schon ein Hindernis. Man hoffte aber auf die aufzustellende Wärmebedarfsberechnung: Denn die ist grundsätzlich erforderlich, bevor man überhaupt in die Auslegung der neuen Anlage einsteigt. Grund dafür auch: Häufig sind die Anlagenwerte, die man vor Ort vorfindet, nur überschlägig geschätzt und haben außerdem noch einen Sicherheitszuschlag, sind also generell deutlich zu hoch.
Das hat sich im Fall Olching bestätigt. Die Folge: Statt der überdimensionierten Leistung der Ölheizung, die für rund 4.500 l Jahresverbrauch sorgte, genügen jetzt die besagten 20 kW aus den zwei kaskadierend geschalteten Luft-/Wasser-Wärmepumpen, um das Haus komfortabel mit Wärme und Warmwasser zu versorgen. Die beiden Wärmepumpen haben dabei eine Folgeumkehrschaltung. So fahren beide Anlagen nicht nur möglichst oft am optimalen Betriebspunkt, sondern zusätzlich wird die Belastung der einzelnen Aggregate verringert und gleichmäßig gestaltet.
Idealerweise konnten die beiden Außeneinheiten an der Rückseite eines benachbarten Gebäudes angebracht werden. Sie sind also, unabhängig von den geringen Laufgeräuschen, künftig nicht nur nicht zu hören, sondern sogar komplett aus dem Blickfeld verschwunden. Für viele Kunden ist das ein wichtiges Argument. Denn ähnlich wie bei den PV-Anlagen vor etlichen Jahren ist der Anblick einer Wärmepumpen-Außeneinheit noch nicht überall akzeptiert. Glücklicherweise dreht sich mittlerweile das Meinungsbild, weil die Hausbesitzer zu ihrer nachhaltigen Wärmeanlage stehen und das bereitwillig zeigen.
Hydraulik: speziell und kreativ
Davor haben die Techniker aber zumindest im Bestand ab und zu noch ganz spezielle Herausforderungen zu stemmen, bestätigte wieder einmal dieses Objekt. Hier war es zum Beispiel die über die Jahre „kreativ weiterentwickelte“ Hydraulik: Ursprünglich war die Wärmeverteilung in Erd- und Obergeschoss als Einrohrsystem angelegt. Später kam noch eine Flächenheizung im zwischenzeitlich ausgebauten Dachgeschoss mit sehr hohen Decken dazu, deren niedrigere Vorlauftemperatur durch eine energiefressende Kaltwasser-Beimischung erreicht wurde.
Eine sehr fragwürdige Lösung! Nun kann dieser Heizkreis dank Wärmepumpe mit 45/40 °C Vor-/Rücklauftemperatur bedient werden. Ein zweiter Heizkreis wurde im Keller als Zirkulation mit einer Spreizung von 60/40 °C neu aufgesetzt und dann durch die Decke geführt, um die kaum abzugleichende Einrohrheizung im Erdgeschoss durch ein zeitgemäßes Zweirohrsystem mit rücklaufgeführten, elektronisch gesteuerten Heizkreispumpen zu ersetzen. Lediglich im ersten Obergeschoss blieb es beim Einrohrsystem, der Umbau wäre sonst zu aufwendig geworden.
Speicher mit Mehrfachfunktion
Für den kontinuierlichen Energienachschub sorgt jetzt ein 1.000-l-Multifunktionsspeicher mit innen liegendem Gegenströmer für die Warmwasserbereitung. Das ist nicht nur energiesparend, sondern darüber hinaus hygienisch, weil nur der tatsächliche Warmwasserbedarf erwärmt wird. Eine Verkeimungsgefahr aufgrund von Stagnation wird so vermieden. Zudem ist der Speicher so dimensioniert, dass die Wärmepumpen eine lange Laufzeit erreichen, also am optimalen Betriebspunkt arbeiten. Wegen des Speichervolumens können außerdem Überschüsse der PV-Anlage per E-Heizstab sowie die Leistung eines projektierten Kaminofens mit Wassertaschen als zusätzliche Wärmeeinträge genutzt werden. Das steigert die Effizienz des Gesamtsystems weiter. Ein getaktet gefahrenes Elektro-Wandheizgerät mit 14 kW Leistung ist zudem als Back-up installiert, um eventuelle Spitzenlasten, beispielsweise während einer besonders harten Frostperiode, abzufangen.
Neue Heizkörper: Mehr Fläche, modernes Design
Weil aber die Wärmeerzeugung und deren Bereitstellung nur der eine Teil der Aufgabe sind, der andere die effiziente Wärmeübergabe an den Raum, wurden im Haus die Heizkörper ausgetauscht. Die alten Platten- und Rippenheizkörper mussten großflächigeren, auf den Wärmebedarf des jeweiligen Raumes abgestimmten Heizflächen weichen.
Dadurch wirken die Räume gleichzeitig auch deutlich moderner, ein oft vernachlässigter Gesichtspunkt. Denn gerade bei der Installation von Wärmepumpen im Bestand sollte es das Ziel sein, die Anlage so bedarfsgerecht wie möglich aufzusetzen. Das funktioniert aber nur, wenn wirklich alle Stellschrauben für eine möglichst effiziente Nutzung der regenerativ gewonnenen Energie benutzt werden. Die Wärmeübertragung ist dabei eine ganz entscheidende, denn sie korrespondiert unmittelbar mit der notwendigen Vorlauftemperatur.
Deswegen wird der abschließende hydraulische Abgleich auch das Sahnehäubchen auf dem nachhaltigen Heizungstausch. So können für das Gesamtsystem nochmals viele Effizienzpunkte gewonnen werden.
Das könnte Sie auch interessieren
Dieser Artikel ist zuerst in KK DIE KÄLTE + Klimatechnik erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen Newsletter der KK.
Zur Anmeldung geht es hier.
Das Fachportal für die Gebäudetechnik